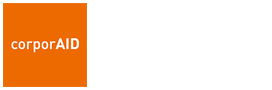Innovationen und Afrika werden immer häufiger in einem Atemzug genannt, doch inwiefern macht sich eigentlich der neue Innovationsgeist am Nachbarkontinent für österreichische Unternehmen konkret bemerkbar? Martin Treml, Regionaldirektor für Afrika beim Gesundheitsdienstleister Vamed, der in 18 afrikanischen Ländern aktiv ist, lächelt: „Im Senegal haben wir ein Innovationsprojekt in der medizinischen Versorgung gestartet und bemühen uns um Wissenstransfer. Dabei müssen wir jedoch dreimal so viele Trainings machen wie geplant, denn die ersten beiden Klienten machen sich mit dem neuen Wissen selbstständig und sind plötzlich unsere Konkurrenten. Das ist für uns nicht unbedingt optimal, wohl aber für Entwicklung und Wachstum.“
Solche Formen von Spillover-Effekten sind Gold wert für die Entwicklung am afrikanischen Kontinent, darin sind sich Treml und sechs weitere Experten einig, die bei einem corporAID Multilogue Ende November über Afrikas Pfad in Richtung Wohlstand diskutierten.
Phasenweise voran
Während in Städten wie Nairobi oder Lagos ein Start-up nach dem nächsten gegründet wird und ganze Entwicklungsschritte – wie das Festnetztelefon – einfach übersprungen werden, fehlt es vielerorts an Lebensgrundlagen wie Wasser, Strom, Straßen, Gesundheitsversorgung. Kann die digitale Transformation den ganzen Kontinent voranbringen oder sollte der Fokus doch mehr auf der „klassischen“ Industrialisierung liegen? Wie können Industrialisierung und Digitalisierung ins Gleichgewicht kommen, damit Afrika den bestmöglichen Entwicklungspfad findet?
Afrika entwickle sich eigentlich gar nicht so großartig anders als Europa oder die USA, es befinde sich nur in einer anderen Entwicklungsphase, sagt Efosa Ojomo (siehe auch Gastkommentar). Der Forscher vom US-amerikanischen Clayton Christensen Institute verweist auf die Entwicklung Südkoreas, das seit den 1950er Jahren den Weg aus der Armut in den Wohlstand erfolgreich beschritten hat, und betont, dass es seiner Meinung nach vielen Ländern Afrikas genauso ergehen kann.
Nur digital reicht nicht

Christopher Maclay arbeitet wie viele andere genau daran. Der Brite ist Head of Growth des kenianischen Start-ups Lynk Kenya, das für den informellen Sektor Kenias eine digitale Vermittlungsplattform bietet und sich selbst als „LinkedIn for the LinkedOut“ bezeichnet. Für Maclay begann alles mit einem Rohrbruch in seiner Wohnung in Nairobi und der folgenden Suche nach einem Installateur. Der erste, den er kontaktierte, kam erst sieben Stunden später, leistete mangelhafte Arbeit und verlangte dafür auch noch eine unverhältnismäßig hohe Vergütung.
Am Tag darauf war das Problem immer noch nicht gelöst, doch dann erreichte Maclay einen Installateur namens Julius, der schnell auf der Matte stand, das Problem löste und einen fairen Preis veranschlagte. Maclays Gedanke war einfach: Julius sollte die Chance für viel mehr Aufträge bekommen – und die Verbraucher einen guten, zuverlässigen Installateur. Mittlerweile hat Lynk Kenya bereits 22.000 Jobs vermittelt, nicht nur Installateure, sondern auch Tischler, Fahrer, Friseure und Köche, zwei Millionen Dollar wurden dadurch verdient, Tendenz deutlich steigend: „Wir fangen gerade erst richtig an“, freut sich Maclay in bester Start-up-Manier.

In Subsahara-Afrika arbeiten 80 Prozent der Menschen im informellen Sektor, hier setzt Maclay an: „Bevor ich nach Kenia gekommen bin, lebte ich in Liberia. Binnen weniger Jahre wurden zwei Studien über Arbeitslosigkeit in Liberia veröffentlicht. Laut Weltbank waren 85 Prozent der Liberianer arbeitslos, der anderen Studie zufolge waren es sieben Prozent. Die Frage ist: Was ist Arbeit? Ich bevorzuge es, den informellen Sektor miteinzubeziehen, denn viel weniger Menschen werden dadurch ausgeschlossen.“ Maclays Start-up will Vertrauen aufbauen, indem es eine besondere Unternehmer-Infrastruktur für den informellen Sektor schafft.
Um diese auf den Weg zu bringen, mussten die eigenen Geschäftskonzepte mehrmals umgeworfen werden. „Anfänglich dachten wir, wir liefern die Technologie und der Rest funktioniert von allein. Doch weit gefehlt. Wir erkannten, dass es unsere Rolle ist, jeden Anbieter in Ruhe offline zu befragen und Background-Checks zu machen. Die Digitalisierung in Afrika erfordert starke analoge Eingriffe“, sagt Maclay und verweist etwa auf den hierzulande umstrittenen Fahrdienstleister Uber, der in Kenia nicht nur einen deutlich besseren Ruf genießt, sondern auch jeden einzelnen Fahrer analog am Steuer trainiert.
Die neuen Technologieanbieter müssen laut Maclay stets danach Ausschau halten, wie sie auch vom Erfolg der Konkurrenz profitieren können. Lynk Kenya selbst würde es etwa ohne den mobilen Bezahldienstleister M-Pesa nicht geben. „Die bedeutendsten Innovationen sind dabei immer an wichtige Handlungsfelder gekoppelt. Es geht nicht um irgendwelche Werbeapps, sondern um Bildung, Gesundheit, Arbeit. Und so toll die Tech-Innovationen auch sind: Afrika braucht gleichzeitig auch die klassische Industrialisierung, Bildungs- und Gesundheitsprogramme. All das muss Hand in Hand arbeiten, sonst funktioniert gar nichts“, sagt Maclay.
Klassische Quelle

Im vergangenen Jahr wurden in Afrika knapp 130 neue Technologie-Hubs eröffnet und 560 Mio. Dollar Risikokapital für Start-ups akquiriert, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Am 14. und 15. Dezember hat in der ghanaischen Hauptstadt Accra die re:publica, Europas größte Digitalisierungskonferenz, ihre erste Afrika-Ausgabe veranstaltet: Ziel war es, den digitalen Austausch zwischen Afrika und Europa zu stärken und auch die Möglichkeiten durch die Digitalisierung für die Entwicklungszusammenarbeit zu eruieren. Vor allem die rasante Ausbreitung der Mobiltelefonie in Afrika – selbst im einkommensschwächsten Fünftel haben zwei Drittel der Menschen Zugang zu einem Handy – wird in diesem Zusammenhang häufig als große digitale Entwicklungschance hervorgehoben. Dass mehr Menschen Zugang zu einem Mobiltelefon als zu einer sauberen Toilette haben, ist aber nicht nur auf die rasante Handyausbreitung, sondern auch auf die schlechte Hygienesituation zurückzuführen. Und um mobile Bezahlsysteme bestmöglich nutzen zu können, hilft das Handy nicht sonderlich weiter, wenn es kein Geld zum Überweisen gibt.

Jesus Crespo-Cuaresma, Institutsleiter für Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, bezeichnet die Digitalisierung in Afrika in diesem Zusammenhang als Katalysator für Entwicklung, aber nicht als Quelle. Diese sei die Industrialisierung. Um Entwicklung voranzutreiben müssten aber auch die politischen Institutionen zumindest dergestalt funktionieren, dass sie Rechtssicherheit für Unternehmen garantieren können.
Interview mit Judith Helfmann-Hundack, Afrika Verein der Deutschen Wirtschaft
Das Rad nicht neu erfinden

Hans Stoisser, Gründer des auf Afrika spezialisierten Beratungsunternehmens Ecotec, verweist darauf, dass ohnehin nicht von einem Entweder-oder gesprochen werden könne, da die Industrialisierung in Afrika ja bereits mitten im Gange sei – angetrieben von chinesischen Unternehmen. Während die einen darüber die Nase rümpfen, sehen andere in China den Industrialisierungsmotor Afrikas, etwa die McKinsey-Expertin Irene Yuan Sun, die gegenüber corporAID betonte (siehe Ausgabe Nr. 75), dass es auf dem Weg zum Wohlstand keine Abkürzungen gebe: Dieser führe über die verarbeitende Industrie bis zur Dienstleistungsgesellschaft. Europäische Unternehmen könnten Afrika bei diesem Weg unterstützen.
Neuer Blickwinkel
Judith Helfmann-Hundack (siehe auch Interview) vom Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft konstatiert ganz nüchtern, dass wir uns angesichts der mangelhaften Aktivität europäischer Unternehmen in Afrika nicht über die dortige chinesische Dominanz wundern bräuchten. Ihrer Meinung nach hat sich der afrikanische Markt aber in den vergangenen Jahren gar nicht so stark verändert, wie bisweilen postuliert. Es sei unser Blick auf Afrika, der sich verändert und verstärkt habe.

Dem kann Nella Hengstler nur zustimmen. Sie war sieben Jahre lang Wirtschaftsdelegierte der Außenwirtschaft Austria im nigerianischen Lagos, bevor sie heuer im August den Posten als Regionalmanagerin für Afrika/Nahost in der Zentrale in Wien übernahm. „Als ich in Lagos angefangen habe, habe ich ganz oft die Frage von heimischen Unternehmern gehört: Sind Sie die mutige junge Frau, die jetzt in Afrika ist? Das höre ich nicht mehr. Das Image Afrikas ändert sich langsam, die Unternehmen sind viel informierter.“ Dieser Awareness-Gewinn gehe aber nicht automatisch mit einem wirklichen Business-Ansturm auf Afrika einher.
Dennoch sei gerade der aktuelle Fokus auf die rasante Digitalisierung in Afrika nicht zu unterschätzen: „Die digitalen Innovationen zeigen uns eine positive Geschichte, die die Menschen auch hier interessiert. In Österreich kannst du die Menschen noch überraschen, wenn du ihnen erzählst, dass du dein Essen in Lagos per App bestellst.“ Dabei sei Afrika in Sachen Digitalisierung Österreich bisweilen sogar einige Schritte voraus. „Ich habe kürzlich in Wien mit einem Taxifahrer geredet, der sagte, es sei gar nicht so einfach für ihn, an ein Point-of-Sale-Kartenterminal heranzukommen, damit die Kunden mit Kreditkarte bezahlen können. In Lagos hat jeder, der unter der Brücke Korbsessel flechtet, so ein Gerät. Speziell im Fintech-Bereich ist in Afrika in den vergangenen Jahren einiges passiert.“
Abschied von Exotik
Vor ihrer Station in Lagos war Hengstler für die Außenwirtschaft Austria in Neu Delhi aktiv, sie sieht rückblickend einige Hinweise, die Efosa Ojomos These der unterschiedlichen Entwicklungsphasen untermauern: „Als ich von 2002 bis 2005 in Indien war, hat sich in Österreich niemand für das Land interessiert. Das war der superexotische Posten. Da fährt man hin zum Yoga machen und um sich den Taj Mahal anzuschauen. Fünf Jahre später war Indien das Boomland, als exportorientierte Firma schaut man sich heute Indien an. Vielleicht steht Afrika und speziell Nigeria jetzt genau an dieser Kippe, dass man sagt: It’s the next big thing.“