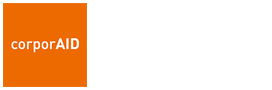Man sitzt im Auto und steht. Und steht. Dann bewegt sich die Wagenkolonne für einen Moment. Schon steht man wieder. Und wartet. Und steht. Man blickt aus dem Wagenfenster: Rückfenster, Autodächer, Busse, Rikschas. Dazwischen schlängeln sich Mopedtaxis hindurch, Straßenverkäufer preisen ihre Waren an und klopfen an die Fensterscheiben, um Snacks, Getränke oder Handykarten anzubieten. Dann kommt der Verkehr in Bewegung. Kurz. Dann steht man wieder. Und wartet. Und steht. Hat man einen wichtigen Termin, darf man nun langsam nervös werden.
Wer in Städten wie Dhaka, Jakarta oder Nairobi unterwegs ist, kennt solche Verkehrsstillstände. Sie gehören dort zum Alltag. Immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer sind mit einem wachsenden Verkehrsaufkommen konfrontiert, das die Ballungszentren undurchdringlich macht. Erhöhter Verkehr ist dabei ökonomisch gesehen nicht unbedingt eine schlechte Nachricht für diese Länder, sondern ein Indikator für zunehmenden Wohlstand. Die Mittelschicht wächst, immer mehr Menschen können sich ein Auto leisten. Das erhöhte Verkehrsaufkommen ist auch eine Folge der zunehmenden Verstädterung. Gerade Städte treiben den Wohlstand an, da in ihnen die Wirtschaft konzentriert und schneller wachsen kann.
Überforderte Städte
„Wir brauchen mehr Ordnung“


Infrastruktur Mensch
Spricht man mit Hubert Klumpner, dann stellt sich die Lage nicht ganz so einfach dar. Klumpner ist Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Stadtentwicklung und dabei auch sehr intensiv mit Schwellen- und Entwicklungsländern. Seiner Überzeugung nach kann die Verkehrspolitik nicht nur für sich, sondern muss mit all den anderen Feldern der Stadtplanung gemeinsam gedacht werden, etwa mit der Umwelt- und Energiepolitik, aber auch der Soziologie und Philosophie. „Die Menschen sind eigentlich die Infrastruktur, um die es geht. Und wir müssen mit den anderen Infrastrukturen die höchstmögliche Qualität für eine größtmögliche Anzahl von Leuten produzieren“, betont er. Dieser ganzheitliche Ansatz ändert auch den Blick auf den Straßenverkehr. Denn, so Klumpner: „Straßen sind an sich nicht das Problem, schon die Römer haben sie gebaut. Es geht darum, wer und was sich auf ihnen bewegt. Das müssen nicht Autos sein.“ Wenn nun aber in Schwellen- und Entwicklungsländern der Straßenbau für den benzingetriebenen Individualverkehr vorangetrieben wird, dann wird laut Klumpner ein Modell aus dem Westen wiederholt, das dieser selbst nicht mehr haben will. Denn in den Industrieländern werden gerade viele Städte zurückgebaut und renaturiert, „weil man sich gewisser Qualitäten bewusst wird: Man will saubere Luft, sauberes Wasser und einen sauberen Boden, der nicht kontaminiert ist.“ Diese Qualitäten sollte man bei künftigen Stadtplanungen von Anfang an mitdenken, anstatt sie nachher zurückgewinnen zu müssen.
Auch Marcela Guerrero Casas, Mitgründerin der Plattform Local South, die Akteure des Globalen Südens verbinden will, arbeitet an Alternativen zum Autoverkehr – etwa am Ausbau von Radwegen. Doch räumt sie ein, dass es in Kapstadt, wo sie lebt, schwierig sei, auf das eigene Auto zu verzichten, wenn man es sich leisten kann. „Denn der öffentliche Verkehr ist schlecht ausgebaut.“ Und dann käme auch noch die Sicherheitsfrage hinzu: So habe sich eine ehemalige Kollegin, die ohne PKW leben wollte, erst kürzlich ein Auto gekauft, nachdem sie an einer Busstation ausgeraubt worden war.
Peer-to-Peer Learning
Warten auf die Wartung
Auf eigenen Spuren




Keine Patentlösung
Bei der Planung des Verkehrs und den Maßnahmen zur Verkehrsbeschleunigung wird es aber keine Patentlösung geben. Casas verweist darauf, dass Städte verschieden angelegt sind. In Südafrika sind sie weitläufig, weil ein großer Teil der Bevölkerung während der Apartheid an den Rand gedrängt wurde. Andere wie Bogotá oder São Paulo sind wieder sehr dicht besiedelt. Manche Städte sind flach, andere hügelig. Und dann gibt es noch den Effekt, dass man mit jedem Angebot auch die Nachfrage erhöht. So wurden in Manila und Bangkok neue große Straßen gebaut – mit der Auswirkung, dass das Verkehrsaufkommen nochmals gewachsen ist und diese Straßen erst recht verstopft sind. Und auch ein attraktives öffentliches Bussystem zieht wiederum mehr Fahrgäste an und kommt schnell an den Rand seiner Kapazitäten. Es muss ständig erweitert und verbessert werden – zumal die Städte ja auch rasant wachsen. Dafür braucht es wiederum eine langfristige Planung und entsprechende Budgets, während sich Förderbanken oft an der Umsetzung einzelner Projekte orientieren.
Eine Maßnahme scheint aber an vielen Orten notwendig zu sein: Um den Verkehrsstillstand aufzuhalten, um die Menschen besser zu verteilen, braucht es Dezentralisierung. Klumpner denkt diese in dem Sinne, dass kleinere und mittlere Städte attraktiv gemacht und durch Infrastruktur, etwa Bahnstrecken, angebunden werden. Er gibt zu bedenken: „Das ist aber auch eine politische Frage, die viel Gestaltungswillen voraussetzt.“
Und auch Khans Empfehlung wäre, in Bangladesch „andere Regionen als Dhaka attraktiv zu machen – einerseits durch Förderungen, aber auch durch Regulierungen, etwa von Betriebsansiedelungen“. Denn derzeit würden die Leute nach wie vor in die Hauptstadt strömen, weil sie sich dort am ehesten eine Einkommensmöglichkeit erwarten. Diese Konzentration auf einen Ort sei aber keine nachhaltige Entwicklung. „Wir brauchen einen klaren Flächenwidmungsplan“, sagt der Stadtplaner. „Nur so kann auch Verkehrsplanung funktionieren.“
Mehr Asphalt
Auf Schiene


Fotos: Sk Hasan Ali, HubPags ASaber91/Flickr Anuradha Dullewe Wijeyeratn, Peter Rigaud, Privat, Turtlewong, weltbank (2), carmudi