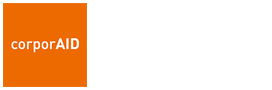Was würde wohl passieren, wenn 20.000 afrikanische Elefanten durch die Lüneburger Heide, das Havelland oder die Allgäuer Hochalpen streifen würden? Wohl nichts Gutes, denn diese deutschen Landschaften böten keine gute Heimat für die tonnenschweren Kolosse, die täglich jeweils 200 Kilo Nahrung und 100 Liter Wasser zu sich nehmen. Und warum sollte man sich eine derart absurde Frage überhaupt stellen? Weil Mokgweetsi Masisi, der Präsident Botswanas, dem Land mit der größten Elefantenpopulation weltweit (135.000 Exemplare), kürzlich öffentlichkeitswirksam verkündete, man wolle Deutschland 20.000 Elefanten schenken – unter der Maßgabe, dass diese wie in Botswana in freier Wildbahn leben dürfen.
Der Hintergrund: Im Februar teilte das deutsche Umweltministerium mit, dass die Einfuhr von Jagdtrophäen geschützter Arten verboten werden solle (noch ist dies in Deutschland oder Österreich teilweise erlaubt, für einige Arten sind jedoch spezifische Genehmigungen erforderlich). Afrikanische Staaten wie Botswana und Namibia befürchten, dass im Falle eines Verbots auch andere Länder bzw. die gesamte Europäische Union nachziehen könnten, mit letztlich negativen Konsequenzen für den Arten- und Naturschutz in Afrika, der sich ganz wesentlich auch durch die Einnahmen aus dem Jagdtourismus finanziert.
Jenseits der Romantik
Mit dem 20.000-Elefanten-Angebot schaffte es Masisi weltweit in die Schlagzeilen – und sorgte wohl auch für manchen Lacher. Nicht jedoch bei Maxi Louis. Sie ist als Direktorin der Naturschutzorganisation NACSO in der namibischen Hauptstadt Windhoek für den nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen des Landes zuständig und gerät in Rage, wenn man sie auf die Verbotsgedanken in Berlin und anderswo anspricht: „Es mag für die Öffentlichkeit in Europa witzig sein. Aber für die Menschen im ländlichen Namibia oder Botswana sind die vielen Elefanten ein reelles Problem: Sie dringen in die Dörfer ein und stellen eine Bedrohung für die Menschen dar. Und vor allem zerstören sie gerade in argen Dürrezeiten viele Bäume und Pflanzen“, sagt Louis.
Selbstverständlich werde versucht, Elefanten und andere Wildtiere bestmöglich zu schützen – so sei etwa die namibische Elefantenpopulation in den vergangenen Jahrzehnten von 4.000 auf 24.000 Exemplare angestiegen. „Doch Natur- und Artenschutz sind mit hohen Kosten verbunden. Und wenn wir die Zahl der Wildtiere stabilisieren und auch weiter erhöhen wollen, wie wir es in den vergangenen Jahren erfolgreich getan haben, müssen wir sicherstellen, dass die lokalen Communities Teil des Systems sind“, erklärt Louis. Und dabei sei, fernab „der Romantisierung wilder Tiere in gemütlichen Wohnzimmern und Kinderprogrammen“, die nachhaltige Jagd eine wichtige Maßnahme, um Einkommen für die Menschen zu erzielen und Tierpopulationen zu regulieren. Dass sich das deutsche Umweltministerium und andere Jagdgegner in Europa den zahlreichen Gesprächsangeboten aus Afrika konsequent verweigerten, hält Louis für kontraproduktiv und rücksichtslos.

Klare Kriterien
In wiederkehrenden Abständen gerät die Trophäenjagd auch in Europa in den politmedialen Diskurs, häufig allerdings ohne die nötigen Präzisierungen. Wann wird das Erlegen von Tieren zu einer Trophäenjagd? Die Trophäenjagd ist eine Praxis, bei der Jäger eine Gebühr zahlen, um unter Anleitung bestimmte Tiere mit spezifischen Merkmalen wie außergewöhnlicher Größe oder großem Geweih zu schießen. Die Trophäen, zumeist Geweihe oder Felle, werden üblicherweise als Erinnerungsstücke behalten. Das Fleisch der erlegten Tiere dient oft als Nahrung für örtliche Gemeinschaften.
Diese Art der Jagd wird normalerweise unter der Kontrolle von staatlichen Wildtierbehörden, Naturschutzorganisationen oder privaten Grundbesitzern legal und reguliert durchgeführt. Für gefährdete Arten gelten strenge Quoten, die von CITES, einer Organisation, die aus dem Washingtoner Artenschutzabkommen von 1973 hervorgegangen ist, jährlich angepasst werden: So dürfen heuer in Namibia 90 Elefanten, 25 Krokodile, 250 eoparden, 150 Geparden und 5 Spitzmaulnashörner gejagt werden. In Botswana sind es 5 Geparden, 130 Leoparden und 400 Elefanten. Pro Jahr werden im Rahmen von Trophäenjagden insgesamt rund 800 Afrikanische Elefanten erlegt. Erlaubt ist dies ausschließlich in Botswana, Namibia, Simbabwe und Südafrika und nur für nicht-kommerzielle Zwecke.
An der Zuverlässigkeit des Systems wird immer wieder gezweifelt. So gibt es Berichte über illegales Überschreiten von Jagdquoten oder das Erlegen nicht genehmigter Arten. Tierschützer kritisieren, dass die Quotierungsverfahren vielerorts intransparent seien. Klar ist jedoch: Die Jagdgebühren finanzieren in vielen Fällen die Ausbildung und Ausstattung von Rangern, die Strafverfolgung von Wilderern und verringern den Anreiz zum illegalen Wildtierhandel, der derzeit viele Arten wie Elefanten und Nashörner gefährdet – allein im Jahr 2022 wurden in Namibia 87 Nashörner von Wilderern getötet.
Die wichtigste Ursache für den Rückgang der Populationen großer Säugetiere wie Elefanten oder Löwen, Zebras oder Antilopen ist laut der internationalen Natur- und Artenschutzorganisation IUCN allerdings der Verlust von Lebensräumen durch die Ausweitung menschlicher Aktivitäten wie der Viehwirtschaft. Die IUCN betont, dass eine gut gemanagte Trophäenjagd ein positiver Treiber für den Naturschutz sei, da sie den Wert der Tierwelt und der von ihr abhängigen Lebensräume erhöhe.
Klaus Hackländer, Leiter des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien, erklärt Zusammenhänge: „In Afrika kommt ein nicht unerheblicher Teil der Einnahmen aus der Jagd der lokalen Bevölkerung zugute. Wenn nun etwa Wildtiere wegen eines Jagdverbots nicht mehr als potenzielle Einnahmequellen betrachtet würden, würden unkontrollierte Wilderei und Mensch-Tier-Konflikte deutlich zunehmen und schließlich zu schweren Rückgängen der Populationen einer Reihe von bedrohten oder ikonischen Arten führen.“ Ein Vergleich illustriert dies: So schrumpften die Wildtierpopulationen in Kenia seit Beginn des Jagdverbots im Jahr 1977 bis 2016 durchschnittlich um 68 Prozent. In Südafrika hingegen erhöhte sich im gleichen Zeitraum die Zahl der bejagbaren Breitmaulnashörner von 2.000 Tieren um 900 Prozent.
Für eine nachhaltige Jagd müssten drei Bedingungen gegeben sein, erklärt Hackländer: Die Jagd müsse ökologisch sinnvoll sein, sich rechnen und auch für die lokale Gesellschaft nützlich sein. Darauf aufbauend ließen sich Kriterien und Indikatoren zur Messung nachhaltiger Jagd entwickeln.
Beteiligung der Bevölkerung
Aus Sicht der IUCN ist es in Namibia gut gelungen, ein nachhaltiges Wildtiermanagement aufzuziehen. Hier generieren ländliche Gemeinden unter dem Dach der erwähnten Naturschutzorganisation NACSO mit 86 sogenannten kommunalen Conservancies, die im Unterschied zu vielen Nationalparks nicht eingezäunt sind, 184.000 Einwohnern und einer verwalteten Fläche von mehr als 160.000 km2 jährlich rund zwei Mio. US-Dollar aus der Jagd – ebenso viel erbringt der Fototourismus. Artenschutztechnisch läuft es gut: So konnte beispielsweise die Population der bedrohten Bergzebras seit Beginn des Programms im Jahr 1998 von weniger als 1.000 auf rund 30.000 Exemplare und die Anzahl der Impalas von knapp 500 auf rund 10.000 gesteigert werden. Und für die Communities ist das Geschäft lukrativ. Für einen erlegten Elefanten etwa erhalten sie 20.000 US-Dollar als Direktzahlung sowie 3.000 Kilogramm Fleisch.
„Der Erfolg des Projekts beruht darauf, dass die lokalen Gemeinschaften an allen Entscheidungen beteiligt sind. Dadurch können wir die Ideale des Natur- und Artenschutzes mit lokalem Benefit verbinden“, sagt NACSO-Direktorin Maxi Louis. Und sie betont: „Wenn die Communities nicht vom Wildtierschutz profitieren, nimmt die Wilderei zu. Es ist ganz einfach: Mit einem erlegten Elefanten können wir 100 Elefanten retten.“ In Jägerkreisen sagt man: „If it pays, it stays.“
Das häufig vorgebrachte Argument, der Jagdtourismus könne durch vermehrten Fototourismus wie beispielsweise Safaris ersetzt werden, scheitert sehr bald an der Realität. Denn Fototouristen haben in der Regel andere Ansprüche als Jäger: Sie erwarten gute Verkehrsanbindungen, minimale Gesundheitsrisiken und garantierte Tierbeobachtung – Bedingungen, die in vielen Gegenden, in denen Trophäenjäger unterwegs sind, nicht gegeben sind. In Tansania zeigt sich beispielsweise, dass sich nur zwei der 16 Nationalparks über Fototourismus finanzieren können. Die anderen Parks sind aufgrund ihrer Größe und der schwierigen Zugänglichkeit auf Einnahmen aus der Jagd angewiesen. Namibia liefert weitere Argumente zugunsten des Jagdtourismus: Jäger machen dort weniger als ein halbes Prozent der Unmengen an Wasser verbrauchenden, Müll erzeugenden und Staub aufwirbelnden Touristenmassen aus, sorgen jedoch für knapp zehn Prozent der Gesamteinnahmen des Tourismus.
Gelebter Artenschutz: NACSO-Chefin Maxi Louis, ihre Mitarbeiter beim Zählen des Tierbestands, Willy Pabst bei der Übersiedlung eines betäubten Elefanten (v.l.)
Naturjuwel in Simbabwe
Der deutsche Unternehmer Willy Pabst weiß, wovon er spricht, wenn es um Foto- und Jagdtourismus geht. Er finanziert sein Wildreservat Sango im Südosten Simbabwes auch mit Fotosafaris, seine 200 lokalen Mitarbeiter könnte er aus diesen Einnahmen aber niemals bezahlen: „Wir machen mit Fototourismus rund 50.000 Dollar im Jahr, mit der Jagd hingegen 700.000“, berichtet der umtriebige 80-Jährige. Ihm gelang es – auch unter Einbringung von eigenem Vermögen – binnen drei Jahrzehnten, ein intaktes naturnahes Habitat mit mehr als 200.000 Säugetieren auf 600 Quadratkilometern zu errichten.
Pabst, der etwa zu gleichen Teilen in Sango, in Kapstadt und in seiner Heimatstadt Hamburg lebt und sich als „größten deutschen Naturschützer“ bezeichnet, übernahm im Jahr 1993 eine heruntergekommene Rinderfarm und begann, Wildtiere anzusiedeln. „Die Nutztierhaltung hat hier angesichts der Dürre einfach keinen Sinn ergeben, denn ein Nutztier braucht anteilig zum Gewicht sieben Mal so viel Wasser wie ein Büffel oder Elefant. Und vor allem holen sich die Wildtiere das benötigte Wasser selbst – unsere überzüchteten Rinder könnten das ja nicht“, gibt er Einblick in seine Motive.
Heute beherbergt Sango allein 250 Nashörner, die laut simbabwischem Recht jedoch nicht gejagt werden dürfen: „Leider“, sagt Pabst. Und fährt fort: „Ich würde nie ein Nashorn jagen, aber ich würde es gern jagen lassen. Es gibt Europäer oder Amerikaner, die dafür 350.000 Dollar ausgeben würden. Wenn ich jedes Jahr zwei von den älteren Nashörnern abschießen lassen könnte, würde sich der ganze Schutz dieser Tiere von allein finanzieren und ich hätte trotzdem weiterhin ein erhebliches Wachstum der Nashornpopulation.“
Bis auf die nicht zur Jagd zugelassenen Nashörner, Geparden und Afrikanischen Wildhunde beherbergt sein Reservat eine ganze Reihe von Tieren, die gejagt werden dürfen: Büffel, Giraffen, Zebras, Gnus, Leoparden. Als „Krönung“ gelte eine kombinierte Elefanten- und Löwenjagd. Sie ist auf 21 Tage ausgelegt, die Jäger zahlen dafür rund 80.000 Dollar. „Es geht bei der Jagd in Afrika nie darum, Mengen abzuschießen“, erklärt Pabst, um dann ebenfalls eine Lanze für die kontrollierte Jagd zu brechen: „Wir schießen vielmehr nach quotenökologischen Grundsätzen. Ich kann verstehen, dass viele Menschen sich dagegen sträuben, dass sich jemand einen Teil eines Elefanten oder Büffels an die Wand hängt. Aber wenn wir die Jagd verbieten, bricht in Afrika die Wildlife Economy zusammen, und wir zwingen die Leute, in den Dürregebieten wieder mit der zum Scheitern verurteilten Rinder- oder Schafzucht anzufangen.“
Die eigene Elefantenüberpopulation macht Pabst Sorgen. Viele Bäume, unter ihnen auch massige Baobabs, haben der Wucht der Elefanten nichts entgegenzusetzen, Giraffen finden dann keine Blätter mehr, Vögel keine Nistplätze, anderen Tieren fehlt der Schatten. Eine Lösung heißt Übersiedlung. In einer spektakulären Aktion hat Pabst bereits vor einigen Jahren hundert Elefanten mit Hubschraubern und LKWs zum rund 800 Kilometer entfernten Sambesi gebracht. 200 weitere will er nun auf eigene Kosten in einen anderen simbabwischen Nationalpark bewegen. Und um die nach wie vor bestehenden finanziellen Lücken zu schließen, schwebt Pabst zukünftig neben der Jagd noch eine weitere Einkommensquelle vor: Emissionszertifikate für die eingesparten CO2-Emissionen durch Aufforstung und Erhalt der Biodiversität.
Zukunft durch Zertifikate
Auch im Bereich der Jagd könnte das Thema Zertifizierungen und Labels zukünftig an Bedeutung gewinnen. Ein internationales Forscherteam um den Agrarökologen Thomas C. Wanger hat bereits vor einigen Jahren ein Ökolabel für nachhaltige Jagd vorgeschlagen: Zertifizierungen wären laut Wanger „die beste Option für die Trophäenjagdindustrie in Afrika, um nachhaltige und ethische Jagdpraktiken darzustellen, die den lokalen Gemeinschaften und dem Erhalt der Wildtiere zugutekommen“. Laut Klaus Hackländer gibt es mit dem Wildlife Estate Label einen gut funktionierenden Vorreiter in Europa, den man für Afrika neu konzipieren könnte. Für ihn wäre dies „ein Paradebeispiel für eine verantwortungsbewusste internationale Zusammenarbeit“.
Daten und Fakten
Zumindest stabil
Vor 100 Jahren lebten rund 10 Mio. Elefanten in Afrika – nun haben sich die Zahlen nach dramatischen Rückgängen bei rund 400.000 stabilisiert.