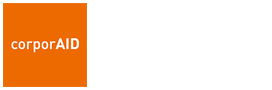Auf Afrika-Tournee in New York: Am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen traf Bundeskanzler Sebastian Kurz Ende September die Staatschefs von Ägypten, Ruanda, Kenia, Ghana, Südafrika und Gambia. Der Hintergrund: Kurz lädt gemeinsam mit dem ruandischen Präsidenten und Vorsitzenden der Afrikanischen Union Paul Kagame zu einem EU-Afrika-Forum am 18. Dezember nach Wien. Dabei soll es vor allem um „Innovation und Digitalisierung“ und damit um das wirtschaftspolitische Potenzial Afrikas gehen. Den Bemühungen zugrunde liegt der anhaltende Wunsch der EU, irreguläre Migration aus Afrika nach Europa zu begrenzen. Bereits beim informellen EU-Gipfel in Salzburg im September war dieser einmal mehr das bestimmende Thema, wirkliche Fortschritte gab es genau wie beim offiziellen Gipfel am 18. Oktober in Brüssel nicht. Ein europäischer Verteilungsschlüssel ist weitgehend vom Tisch. Eine mögliche Partnerschaft mit Ägypten wurde in Salzburg zwar als Vorbild beschworen, jedoch lehnt Ägypten so wie alle anderen nordafrikanischen Länder die von Kurz im Sommer noch gepriesenen und mittlerweile fallen gelassenen „Anlandeplattformen“ für im Mittelmeer aufgegriffene Bootsflüchtlinge ab.
Während also in puncto Verteilung von Flüchtlingen weiterhin vor allem Dissens herrscht und kontrovers über Seenotrettung im Mittelmeer diskutiert wird, hat sich mit der „Hilfe vor Ort“ ein Thema gefunden, auf dessen Wichtigkeit sich alle Beteiligten einigen können. Dieses müsse nun aber auch endlich auf nachhaltige Lösungen ausgerichtet werden, mahnt Rainer Thiele, Entwicklungsexperte der europäischen Migrations-Forschungsallianz MEDAM: „Bisher liegt der Schwerpunkt der Kooperation darauf, Ländern wie Niger dabei zu helfen, Schleuseraktivitäten zu unterbinden und ihre Grenzkontrollen zu verstärken. Das ist eine Art Bestechung. Die Europäer geben den Afrikanern dafür Geld, dass sie die Migrationsströme eindämmen. Aus entwicklungspolitischer Sicht ist es sehr fraglich, ob das diesen Ländern langfristig hilft, die Gründe für die Migration zu bekämpfen.“
Ordnungsversuche

Die Anzahl an Menschen, die irregulär nach Europa kommen, ist mittlerweile verhältnismäßig moderat. Die Internationale Organisation für Migration IOM zählte heuer bis zum 14. Oktober 109.246 illegale Grenzübertritte in die EU (davon 88.837 auf dem Seeweg, 1.839 Menschen ertranken bereits heuer im Mittelmeer), ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum – auf dem Höhepunkt der „Flüchtlingskrise“ waren es mehr als 1,8 Millionen im Jahr 2015. Doch das globale Ausmaß an erzwungenen Migrationsbewegungen hat an Dramatik nicht verloren: Ende vergangenen Jahres waren 68,5 Mio. Menschen weltweit auf der Flucht, 40,3 Mio. davon als Binnenvertriebene, weitere 18 Mio. suchten Schutz in anderen Entwicklungsländern. In der EU befanden sich 3,7 Mio. Flüchtlinge und Asylwerber, wobei eine fehlende Differenzierung zwischen den Kategorien der (freiwilligen) Migration, (erzwungenen) Flucht und dem nur auf letztere ausgelegten Asylsystem das Finden von Lösungen verkompliziert.
Seitens der Vereinten Nationen ist man auch deswegen aktuell sehr um Ordnung und Struktur bemüht, zwei große globale Abkommen sollen die internationale Zusammenarbeit bei den Themen Migration und Flucht verbessern. Als erstes wird im Dezember in Marrakesch mit dem Global Compact for Migration das erste globale Migrationsabkommen vorgestellt. Darin sind 23 Ziele samt konkreter Instrumente zur Umsetzung für eine bessere Migrationspolitik formuliert. Diese fokussieren zum einen auf den Schutz und die Rechte von Migranten und einen entschlosseneren Kampf gegen Menschenhandel und Ausbeutung. Andere Ziele betreffen einen gut koordinierten Grenzschutz sowie Möglichkeiten der Reintegration nach einer Rückkehr ins Heimatland.
Der Pakt unterstreicht dabei ganz nüchtern, dass Migration sich weder durch Abschottung noch durch Entwicklungshilfe verhindern lässt – und dass beiderseits erwünschte Migration eine „Quelle globalen Wohlstands, Innovation und nachhaltiger Entwicklung“ sein kann, wenn sie gut geordnet und sicher gehandhabt wird. Bindend ist der Pakt nicht – und die USA sowie Ungarn winkten ohnehin bereits ab. Hierzulande macht die FPÖ gegen das Papier mobil, und die ÖVP fordert nun Nachverhandlungen. Einer der Autoren des Abkommens, Migrationsexperte Belachew Gebrewold (siehe Interview) vom Management Center Innsbruck, sieht das Papier vor allem als eine gute Diskussionsgrundlage, erwartet aber nicht, dass die einzelnen Staaten ihre Migrationspolitik daran ausrichten.
Fokus auf Nachbarländer
Um auch die irreguläre Migration stärker einzudämmen, sollen bessere Perspektiven vor Ort geschaffen werden. Zur Zeit werden in diesem Zusammenhang vor allem Stimmen laut, die einen verstärkten Blick auf die Nachbarländer von Krisenstaaten fordern. Dort muss es laut dem Oxford-Ökonomen Paul Collier Beschäftigungsangebote für Migranten und Flüchtlinge geben – denn Arbeit schaffe Autonomie. „Wir können heute die Arbeit zu den Menschen bewegen. Es ist völlig wahnwitzig zu glauben, wir sollten die Flüchtlinge dahin bewegen, wo die Jobs sind“, sagte Collier gegenüber dem Spiegel.
Auf Colliers Initiative fußt das EU-Jordanien-Abkommen von 2016, das unter anderem die Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen in Jordanien vorsieht, für die besondere Handelsbedingungen in der EU gelten, mit der Auflage, dass dort mindestens 15 Prozent syrische Flüchtlinge beschäftigt werden. Es gibt aber Probleme bei der Umsetzung. Vielen Syrern fehlt die nötige Erfahrung in der herstellenden Industrie. Zudem gibt es Anlaufschwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen jordanischen und europäischen Unternehmen. Dennoch halten beide Seiten an dem Abkommen fest.
Interview mit Belachew Gebrewold, Management Center Innsbruck
Management statt Illusionen
Uganda, das mehr als eine Million südsudanesische Flüchtlinge aufgenommen hat, hat einen ähnlichen Ansatz gewählt: Indem es Flüchtlingen Land zur Bewirtschaftung überlässt, soll ihnen ein würdiges Leben ermöglicht und zugleich der Nordwesten Ugandas stärker entwickelt werden.
Alte und neue Vorschläge
In Österreich hat die SPÖ kürzlich im Rahmen der Diskussion um ihr neues Migrationspapier den Vorschlag der Charter Cities wieder ins Rennen gebracht. Die Idee dahinter stammt vom US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler und diesjährigen Nobelpreisträger Paul Romer, der bereits seit Jahren städtische Enklaven in Entwicklungsländern fordert, die von Industrieländern errichtet und verwaltet werden. Auf die Flüchtlingspolitik übertragen stellte die SPÖ zur Diskussion, dass Sonderzonen etwa in Afrika eingerichtet werden könnten, die von den VN verwaltet werden, in die Flüchtlinge zurückkehren und dort einer Beschäftigung nachgehen können.

„Das Konzept der Charter Cities ist verbrannt, das Etikett des Neokolonialismus wird es nicht mehr los“, sagt Joachim Rücker. Der deutsche Volkswirt und ehemalige Präsident des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen hat gemeinsam mit dem ehemaligen Leiter des Flüchtlingslagers Zaatari in Jordanien, Kilian Kleinschmidt, ein eigenes Konzept für die Einrichtung sogenannter Sustainable Development Zones SDZ entworfen, das zwar an die Charter Cities und auch an traditionelle Sonderwirtschaftszonen angelehnt ist. Den Erfolg der Zonen machen die Initiatoren aber von einer engen Verknüpfung mit den benachbarten Gemeinden und Städten abhängig.
Angebot für Gestrandete
Dabei richtet sich das Angebot grundsätzlich weniger an Flüchtlinge, die aus Europa zurückkehren sollen, sondern vielmehr an die deutlich größere Zahl an Menschen, die Rücker selbst als „die Gestrandeten“ bezeichnet. „Das sind alle diejenigen Flüchtlinge und Migranten, die vor Unterdrückung, aber auch vor absoluter Armut davonlaufen und die häufig nicht weiterkommen als bis zu den Großstädten im eigenen Land oder in benachbarte Länder, und die dann in prekäre Situationen geraten. Was geschieht denn eigentlich mit diesen Menschen, die sich sozusagen schon halb auf der Flucht befinden?“
Für die Einrichtung einer solchen Entwicklungszone soll ein Administrator betraut werden, sobald der rechtliche Rahmen mit der nationalen Regierung abgesteckt ist. Dieser vergibt Aufträge für Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, die anfänglich von den „klassischen Gebern“ der Entwicklungshilfe sowie privaten Investoren finanziert werden müssen. „Wir haben klare Signale, dass viele internationale Konzerne bereit wären, dort zu investieren, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Rücker.
Zeitgleich soll es vor allem den lokalen KMU der Aufnahmegesellschaften ermöglicht werden, sich in der SDZ anzusiedeln und in ihr zu wachsen. In einem nächsten Schritt soll die Zone sich selbst tragen. E-Governance, E-Finance und weitere Innovationen können dann greifen, sodass sich die klassischen Geber letztlich zurückziehen. „Wir sitzen mit Akteuren zusammen, die das Modell umsetzen wollen, etwa in Libyen. Ich bin davon überzeugt, dass unser Vorschlag auf Dauer erfolgreich sein wird“, sagt Rücker. Die Schlüsselrolle komme dabei nicht der Entwicklungszusammenarbeit, sondern der Wirtschaft zu.
Fokus auf Ausbildung
Entwicklungszusammenarbeit sollte ohnehin nicht als Instrument der Migrationspolitik betrachtet werden, sagt Entwicklungsexperte Thiele, einen Einfluss auf Migration habe sie aber natürlich dennoch. Thieles Forschungen zeigen: „Wenn man in öffentliche Güter wie Bildung und Gesundheit investiert, dann gibt es einen negativen Effekt auf die Migrationsrate. Wenn man für höhere Einkommen sorgt, ist eher das Gegenteil der Fall. Denn dann können sich einige die Emigration überhaupt erst leisten.“
Entsprechend rückt auch in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit das Thema Berufsbildung immer stärker in den Vordergrund. Das neue Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik legt einen Schwerpunkt auf „Hilfe vor Ort“ und nennt arbeitsmarktorientierte Berufsbildung dabei als wesentlichen Faktor. Konkret engagiert sich die heimische Entwicklungszusammenarbeit aktuell etwa für die Ausbildung von Solartechnikern in Äthiopien, während sich die schweizerische für landwirtschaftliche Ausbildungsmöglichkeiten in Niger einsetzt. Und der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller hat kürzlich diverse Ausbildungsvereinbarungen mit Unternehmen in Tunesien geschlossen, laut Müller ist dies die wirksamste Hilfe vor Ort, wobei ein langer Atem gefragt ist. Müller: „Das Thema wird uns die nächsten 50 Jahre beschäftigen.“