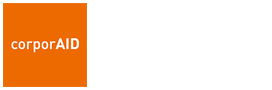Spätestens ab dem Zeitpunkt, als die Einheimischen begannen, aus Angst vor Ansteckung einen großen Bogen um die deutschsprachigen Besucher zu machen, und den Supermarktmitarbeitern beim Anblick von Europäern der Angstschweiß auf der Stirn stand, war klar, dass das Coronavirus auch in Südafrika angekommen ist. Und dass diese Reise nun, Mitte März 2020, vorzeitig beendet war. Was als Recherchetrip zu Marktchancen für österreichische Unternehmen am Kap begonnen hatte, endete mit einer überstürzten Abreise unter Nutzung einer der letzten Flugverbindungen nach Wien. Kurz darauf verkündete der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa den möglicherweise weltweit strengsten Lockdown, eine weitgehende Einschränkung der Bewegungsfreiheit, zu der Maßnahmen wie ein Verbot von Alkohol- und Zigarettenverkäufen noch hinzukamen. Zur Durchsetzung mobilisierte der Präsident mehr als 70.000 Soldaten – die gesamte südafrikanische Armee –, die bisweilen auch mit Gummigeschossen auf Menschen feuerten, die sich nicht an die Ausgangssperre hielten.
Verlauf weiter offen
Mittlerweile wurden die Einschränkungen deutlich erleichtert – die Gesundheitskrise ist jedoch noch lange nicht durchgestanden. „In Ländern mit einem drakonischen Lockdown wie Südafrika wurde der ökonomische Druck so groß, dass sie die Maßnahmen zwangsweise lockerten, bevor sie bei den Infektionen den Höhepunkt erreicht haben“, sagt Tim Heinemann, Ökonom und Afrika-Experte der deutschen Förder- und Entwicklungsbank KfW (siehe Interview rechts).
In Südafrika steigen die Infektionszahlen nun verhältnismäßig rasch, Mitte Juni verzeichnete das Land rund 80.000 Fälle (und knapp 1.700 Tote). Das sind viel mehr Infektionen als in allen anderen Ländern Afrikas, aber noch immer deutlich weniger als in den Corona-Hotspots in Europa, Nord- und Südamerika sowie mittlerweile auch in Südasien. Neben der kurzfristigen Steigerung der Testkapazitäten und der Anzahl an Krankenhausbetten hat sich der im Kampf gegen HIV in den vergangenen Jahren forcierte Aufbau einer dezentralen Gesundheitsversorgung nochmals gelohnt – zehntausende Gemeindegesundheitsbeauftragte untersuchen die Bevölkerung gezielt auf Covid-19-Symptome. Zudem stellt das Land massenhaft Beatmungsgeräte in lokaler Produktion her.
Südafrika stellt mit seinem entschlossenen Kampf gegen die Corona-Pandemie trotz vieler ungelöster Probleme durchaus ein Sinnbild für den ganzen Kontinent dar. Die pessimistischen Prognosen von bis zu drei Millionen Toten, die die Vereinten Nationen zu Beginn der Krise für Afrika stellten, haben sich bisher zumindest nicht bestätigt. Mitte Juni gab es in Afrika insgesamt rund 260.000 gemeldete Infektionen und 7.000 Todesfälle. Angesichts der aktuellen Steigerungsraten befürchtet die Weltgesundheitsorganisation WHO allerdings immer noch, dass bis Jahresende knapp 200.000 Menschen in Afrika dem Virus zum Opfer fallen könnten. Dennoch muss positiv hervorgehoben werden, dass sowohl fast alle afrikanischen Regierungen als auch viele Unternehmen rasch auf die Krise reagiert und so etwa in kurzer Zeit verhältnismäßig große Mengen an Schutzausrüstung und -masken sowie Desinfektionsmittel hergestellt haben.

Existenzen in Gefahr
Unabhängig vom weiteren Verlauf der Infektionszahlen werden die dramatischen sozioökonomischen Auswirkungen der Krise bereits sichtbar. Und während in Südafrika wie in vielen Ländern des Kontinents das Coronavirus anfänglich als Krankheit der Reichen galt – schließlich waren es Reisende und Geschäftsleute aus Europa sowie aus Europa zurückkehrende Einheimische, die das Virus ins Land gebracht hatten – zeigt sich, dass es letztlich vor allem die Ärmsten sind, die unter den Auswirkungen zu leiden haben.
Eine schwerwiegende direkte Folge der Lockdown-Maßnahmen ist dabei die fast vollständige Schließung des für einen großen Teil der afrikanischen Bevölkerungen lebenswichtigen informellen Sektors: Social Distancing und Home Office sind für einen Straßenverkäufer, der sich wenige Quadratmeter mit vielen Familienmitgliedern teilt, schlichtweg unmöglich, die strengen Maßnahmen also unmittelbar existenzgefährdend. Dazu kommen die indirekten Auswirkungen des globalen Abschwungs, der die afrikanischen Volkswirtschaften in ihren Grundfesten erschüttert. Fehlende Exportmöglichkeiten, sinkende Rohstoffpreise und Währungsabwertungen können von den einzelnen afrikanischen Ländern ebenso wie die wegfallenden Einnahmen durch die brachliegende Tourismusindustrie und die ausbleibenden Rücküberweisungen (siehe Kästen) nur bedingt beeinflusst werden. Laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen könnte knapp die Hälfte aller Arbeitsplätze in Afrika aufgrund der Krise verloren gehen. Die Weltbank rechnet mit 60 Millionen Menschen, die heuer krisenbedingt in die extreme Armut abrutschen, die Hälfte davon in Subsahara-Afrika.
Differenzierung notwendig
Zudem grassieren andere tödliche Krankheiten viel stärker als in den Vorjahren, da sie aufgrund der Konzentration auf die Corona-Bekämpfung kaum mehr adäquat behandelt werden können. So starben im Vorjahr weltweit 405.000 Menschen an Malaria, größtenteils Kinder unter fünf Jahren – und fast alle in Afrika. Für 2020 befürchtet die WHO nun, dass sich diese Zahl wegen geschlossener Krankenhäuser und der fehlenden Verteilung von Medikamenten und Moskitonetzen fast verdoppeln wird. Auch die Zahl der Tuberkulose- und AIDS-Toten wird, Prognosen zufolge, wegen der Corona-Maßnahmen heuer deutlich steigen. Darüber hinaus drohen akute Hungerkrisen: Laut dem Welternährungsprogramm könnte sich die Zahl der weltweit von akuter Ernährungsunsicherheit Betroffenen auf 265 Millionen Menschen verdoppeln.
Hätten die Maßnahmen in vielen afrikanischen Ländern also differenzierter und an die sozioökonomischen Realitäten angepasster ausfallen müssen – etwa mit Verboten von sozialen und religiösen Versammlungen, aber ohne die massiven Einschränkungen des (informellen) Erwerbslebens? Lee Crawfurd vom Entwicklungs-Think Tank Center for Global Development verweist darauf, dass viele Menschen in Afrika die Maßnahmen für einen gewissen Zeitraum mitgetragen haben, einer im Senegal durchgeführten Studie zufolge rund drei Wochen. „Dass in einigen Ländern aber immer noch undifferenzierte Einschränkungen herrschen, scheint trotz der gebotenen Vorsicht ein zu hoher Preis zu sein“, sagt er.
Dabei habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, dass lokal organisierte Kampagnen, die auf Abstandsregeln hinweisen und Praktiken wie das Tragen von Gesichtsmasken und Händewaschen fördern, sehr hilfreich seien und dabei ohne die enormen Kollateralschäden der landesweiten Lockdowns auskämen.
Bei alldem sollten auch die großen Unterschiede zwischen den einzelnen afrikanischen Staaten nicht außer Acht gelassen werden. Während Ghana im Rahmen seiner Möglichkeiten professionell agiert hat, versagt Tansania auf der ganzen Linie. Präsident John Magufuli setzt nicht nur auf Verschwörungstheorien und natürliche Heilmethoden, sondern lässt die rasant steigenden Fallzahlen nun bereits seit Ende April auch nicht mehr veröffentlichen.

Interview mit Tim Heinemann, Afrika-Ökonom
Ausblicke für Afrika
Pulverfass Lateinamerika
Auch der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat kürzlich bestimmt, dass in seinem Land die Gesamtzahl der Corona-Toten nicht mehr bekanntgegeben werden soll – was vom Verfassungsgericht binnen Tagen wieder aufgehoben wurde. Tatsächlich ist Lateinamerika aktuell das globale Zentrum der Coronakrise. In Brasilien, wo mit dem Höhepunkt der Todesrate erst im August gerechnet wird, gab es Mitte Juni rund 950.000 Coronafälle und mehr als 46.000 Tote. Auch Peru, Chile und Mexiko sind stark betroffen. Während Uruguay und Argentinien frühzeitig mit Maßnahmen reagierten, zeigen sich Bolsonaro und der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador zögerlich – Bolsonaro tat das Virus lange als harmlose Grippe ab. „Sehr deutlich sehen wir in Lateinamerika die Unterschiede zwischen populistischen Regierungschefs und Entscheidungsträgern, die auf wissenschaftliche Evidenz bauen“, sagt Merike Blofield, Direktorin des GIGA Instituts für Lateinamerika-Studien in Hamburg.
Neben den enormen gesundheitlichen und sozioökonomischen Krisenerscheinungen drohen schon die nächsten Auseinandersetzungen – Lateinamerika war bereits vor der aktuellen Krise ein politisches Pulverfass, dieser Zustand dürfte sich nun weiter verschärfen. Nicht nur in Brasilien, wo bereits rund 30 Anträge auf Amtsenthebung gegen Bolsonaro eingebracht wurden und die Währung zurzeit massiv an Wert verliert. „Besonders auch in Chile, wo enorme Ungleichheit herrscht und die Regierung nur zögerlich auf die Bedürfnisse großer Bevölkerungsteile reagiert, wird es erneut hochhergehen“, prophezeit Blofield.
Die Wut der Menschen in vielen Ländern Lateinamerikas wird von der massiven Veruntreuung von Geldern im direkten Kontext der Krise weiter angeheizt: Der Vizepräsident Panamas trat zurück, als herauskam, dass er absichtlich deutlich überteuerte Beatmungsgeräte gekauft hatte, Boliviens Gesundheitsminister wurde wegen eines ähnlichen Vergehens verhaftet. In Brasilien verschwanden hunderte Millionen Euro, die für Notfallkrankenhäuser gedacht waren, in Kolumbien wird gegen 14 von 32 Gouverneuren wegen Korruption im Zusammenhang mit Corona-Geldern ermittelt und die staatlichen Krankenhäuser Ecuadors gaben für Leichensäcke mehr als das Dreizehnfache ihres Marktwertes aus.
Ein Hoffnungsträger Lateinamerikas ist hingegen das kleine Uruguay. Das Land hat schnell reagiert, bereits nach dem ersten Coronafall die Schulen geschlossen, baut ansonsten aber vor allem auf Freiwilligkeit. Es gab Mitte Juni insgesamt weniger als 1.000 Infizierte in Uruguay, und das tägliche Leben geht fast normal weiter. Laut Blofield liegt das auch daran, dass es dem Land in den vergangenen Jahrzehnten neben der deutlichen Verbesserung der Wohnsituation gelungen ist, einen Großteil der Arbeitsplätze zu formalisieren. Dadurch profitieren viele Bürger vom Sozialsystem – und können Social-Distancing-Vorgaben einhalten. Marco García, WKÖ-Wirtschaftsdelegierter mit Sitz in Buenos Aires, hält Uruguay auch wirtschaftlich gesehen für den „neuen Musterknaben“ in der Region: „Es gibt eine kleine Delle im Wirtschaftswachstum, aber Uruguay wird sich schnell erholen und diese bereits 2021 wieder ausgebügelt haben“, sagt García.
Erste Lehren
Für ein wirkliches Fazit über die Corona-Situation in Afrika und Lateinamerika ist es noch zu früh. Während in der Eindämmung der Pandemie erfolgreiche Länder bereits am wirtschaftlichen Wiederaufbau arbeiten, schießen andernorts die Infektionszahlen in die Höhe.
Was die Krise aber bereits jetzt deutlich gemacht hat: Populistisch untermalte Alleingänge – von Tansania bis Brasilien – helfen nicht weiter. Es braucht internationale Zusammenarbeit, um sowohl das Virus als auch die Wirtschaftskrise, die uns noch eine ganze Weile beschäftigen wird, wirkungsvoll zu bekämpfen.
Fotos: World Bank/Sambrian Mbaabu, KB Mpofu/ILO, World Bank/Henitsoa Rafalia
Stark betroffene Sektoren
Unterbrochene Lieferketten

Viele Entwicklungsländer sind Rohstoffexporteure, die temporäre Stilllegung von Produktionen in Industrieländern und die globale Rezession führen zu harten Einschnitten. So konnte Südafrika in den vergangenen Monaten kaum Mineralien, die Elfenbeinküste kaum Kakao, Simbabwe kaum Macadamia-Nüsse und Kenia kaum Blumen exportieren – gerade bei letzterem steigt zwar aktuell die Nachfrage aus Europa wieder, aber die Transportmöglichkeiten sind nicht gegeben. Der völlige Einbruch des Ölpreises erschüttert Länder wie Nigeria oder Angola zusätzlich – in Nigeria werden die Einnahmen aus den Rohölverkäufen in diesem Jahr um 80 Prozent zurückgehen.
Ausbleibende Touristen

Hotel auf den Fidschi-Inseln
Der Tourismus ist weltweit zum Erliegen gekommen – von den Pyramiden von Gizeh und bis zu den Ruinen von Machu Picchu sind die Hot Spots des Fremdenverkehrs menschenleer. Für viele Entwicklungsländer ist das ein Desaster, allein in Afrika trägt der Tourismus knapp zehn Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bezeichnete den Tourismus als das „neue Gold“ – nun bleibt dieses im beziehungsweise am Boden. Denn selbst wenn Touristenattraktionen aktuell wieder ihre Pforten öffnen, fehlen die Flugverbindungen. Viele Airlines stecken in immensen Schwierigkeiten. So könnte die bereits zuvor angeschlagene South African Airways womöglich gar nicht mehr abheben.
Fehlende Geldflüsse

Rücküberweisungen von Migranten in ihre Herkunftsländer sind in vielen Entwicklungsländern bedeutende Devisenquellen und machen etwa in Tonga, Haiti oder im Südsudan mehr als ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus. Nun prognostiziert die Weltbank, dass wegen der aktuellen Krise die Rücküberweisungsströme in diesem Jahr um rund 20 Prozent und damit um mehr als 100 Mrd Dollar zurückgehen werden. Neben mangelnden Einkünften erwies sich die Schließung vieler Agenturen, welche die Geldtransfers abwickeln, in den vergangenen Monaten als großes Problem. Die Weltbank fordert, dass Geschäfte, die Geldtransfers anbieten, als systemrelevant eingestuft werden und offen halten dürfen.
Ein großes Plus

Die Gesundheitssysteme der meisten Entwicklungsländer sind mit der Corona-Pandemie überfordert. In Windeseile versuchen viele Staaten nun, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, stampfen Notkrankenhäuser aus dem Boden und versuchen, an Schutzausrüstung zu kommen. Nun besteht die Hoffnung, dass auch über die Pandemie hinaus verstärkt in die Gesundheitsversorgung investiert wird. Die ghanaische Regierung hat bereits angekündigt, 40 zusätzliche Spitäler zu bauen. Und der nigerianische Privatsektor springt in dieser Hinsicht bereits jetzt für den überforderten Staat in die Bresche. Im Gesundheitsbereich dürften sich dabei auch enorme Marktchancen für europäische Unternehmen bieten.