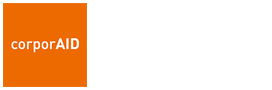Alois Heigl geht rastlos auf und ab in seinem Lokal im 6. Wiener Gemeindebezirk, eine Geste, ein Wort jagt das nächste, wenn er über sein Heimatland Venezuela spricht. Plötzlich bleibt er stehen und ringt mit Tränen in den Augen nach den richtigen Worten: „Venezuela ist tot. Es gibt keinen Horrorfilm, der schlimmer ist als die Realität in Venezuela. Es wird drei oder vier Generationen dauern, bis das Land wieder auf die Beine kommt“, flüstert er. Eine Weile zuvor hatte der Autor und Gastronom, der Venezuela aus politischen Gründen im Jahr 2000 den Rücken kehrte und nach Wien, ins Land seiner Großeltern, übersiedelte, das Gespräch noch in lateinamerikanischer Lässigkeit begonnen. Am Ende bleibt nur Fassungslosigkeit.

Autor und Gastronom
Die Bilder, die uns zur Zeit aus Venezuela erreichen, geben ihm recht: Menschen wühlen im Müll nach Essensresten, prügeln sich um ein Stück Butter, trinken Wasser aus der Kanalisation. 87 Prozent der Bevölkerung lebte im Vorjahr in Armut, zwei Drittel der Venezolaner verloren 2017 deshalb an Gewicht, im Schnitt elf Kilo, zudem gibt es kaum noch Medizin. Bereits 2,3 Millionen Menschen haben das 30-Millionen-Einwohner-Land in den vergangenen Jahren verlassen. Der Internationale Währungsfonds beziffert die diesjährige Inflationsrate auf 1.370.000 Prozent, den Venezolanern kann es nur noch darum gehen, ihre Einkünfte schnellstmöglich wieder los zu werden. Mittlerweile muss in Venezuela sogar für Benzin bezahlt werden. Das klingt angesichts des grassierenden Hungers unbedeutend, hat aber eine hohe symbolische Note: Schließlich war im erdölreichsten Land der Erde der Sprit bislang so stark subventioniert, dass man für einen Euro eine Million Liter hätte tanken können.
Und es ist keine Besserung in Sicht: Der Hafen von Caracas ist verwaist, es kommen kaum noch Importe ins Land. Österreichische Unternehmen haben 2015 noch Waren im Wert von 140 Mio. Euro nach Venezuela geliefert, 2017 waren es nur noch 11 Mio. Euro. Das Außenwirtschaftscenter Caracas wurde jüngst geschlossen – das hänge ganz einfach damit zusammen, dass die venezolanische Regierung von Jahr zu Jahr weniger Devisen für Warenimporte zur Verfügung stelle, erklärt WKO-Wirtschaftsdelegierter Hans-Jörg Hörtnagl.
Währungsabwertung

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro präsentierte im August seine Lösung für die Probleme: eine drastische Währungsabwertung und Anpassung an den Schwarzmarktkurs, auf dem längst die Preise der meisten Güter basieren. Außerdem wurde die Währung Bolivar durch den neuen „souveränen Bolivar“ ersetzt, fünf Nullen wurden gestrichen und der souveräne Bolivar an die Kryptowährung Petro, die mit Rohöl unterlegt ist, gekoppelt. Bereits jetzt lässt sich konstatieren, dass das nichts gebracht hat. Auch heute stehen die Menschen stundenlang vor Banken an, in der Hoffnung, zumindest etwas Bargeld zu bekommen. Es gibt aber nicht genügend Scheine, und die Banken geben vielerorts umgerechnet nur rund einen Euro pro Person aus.
Die Menschen sind jedoch vom Bargeld abhängig, denn die Supermärkte, in denen sie mit Karte bezahlen könnten, sind leergefegt. Am Schwarzmarkt gibt es zwar Lebensmittel, diese müssen jedoch bar bezahlt werden. Genau wie die öffentlichen Busse, auf die viele Menschen angewiesen sind. Ein Teufelskreis. Laut dem Ökonomen Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat die Währungsabwertung die Inflation sogar noch verstärkt (siehe Interview). Ihm ist darüber hinaus überhaupt nicht klar, wie die neue Kryptowährung funktionieren soll.
Niedergang der Ölindustrie
Maduro führt die Regierungsgeschäfte seit dem Tod seines Vorgängers Hugo Chávez im März 2013. Er übernahm einen korrupten Staatsapparat und eine marode Wirtschaft. Und machte alles noch schlimmer. Auf hohe Schulden wurde mit dem Drucken immer neuer Geldmengen reagiert, dadurch stiegen die Preise, Löhne verloren an Wert. Seit drei Jahren befindet sich das Land nun in einer Krise, die außerhalb von Kriegsgebieten ihresgleichen sucht.
Interview mit Klaus-Jürgen Gern, Institut für Weltwirtschaft
Nur ohne Maduro
Vor allem der Niedergang der venezolanischen Erdölindustrie ist dramatisch, denn dieser ist gleichbedeutend mit dem Niedergang der gesamten Wirtschaft – 96 Prozent der Devisen erwirtschaftete die Erdölproduktion. Dabei liegt der Hauptgrund für das Fiasko nicht im schwankenden Ölpreis, sondern in der geförderten beziehungsweise nicht geförderten Menge. Während die internationale Nachfrage nach wie vor hoch ist, sinkt die Produktion seit Jahren, mittlerweile hat sie den Stand der 1950er Jahre erreicht.
Doch statt die heruntergekommenen Förderanlagen zu warten, zu erneuern, neue Ölbohrungen in Auftrag zu geben, Technologien und Fachkräfte ins Land zu holen, fallen immer größere Teile der Produktion aus, verschuldet sich die Regierung immer weiter, druckt immer mehr Geld, verliert immer mehr Vertrauen und schlittert immer tiefer in die Hyperinflation.

Adiós, democracia!
Die wirtschaftliche Misere des Landes geht Hand in Hand mit einer fortschreitenden Aushöhlung der Demokratie. Spätestens seitdem Maduro im vergangenen Jahr eine verfassunggebende Versammlung einsetzte, deren Wahl massiv gefälscht war und von der Opposition boykottiert wurde, und damit das Parlament, in dem die Opposition die Mehrheit Sitze innehat, entmachtete, ist Venezuela keine Demokratie mehr. Der Vorsitzende der Versammlung, Diosdado Cabello, gilt vielerorts als wahre Nummer eins im Staat und als einer der korruptesten Politiker des Landes. Die Pressefreiheit ist massiv eingeschränkt, alle wichtigen Positionen in Justiz, Politik und Wirtschaft sind mit Gefolgsleuten besetzt. Und das regimetreue Militär genießt besondere Privilegien, kontrolliert zudem den blühenden Schmuggel. Die Gewalt auf den Straßen nimmt täglich zu, Venezuela ist eines der unsichersten Länder der Welt. Caracas hält sich seit Jahren unter den Top 3 der gefährlichsten Städte der Welt, 3.387 Morde wurden 2017 offiziell gezählt, die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. „Ab 18 Uhr kann man sich in Caracas kaum noch auf die Straße trauen“, sagt Heigl. Das hängt auch damit zusammen, dass Ex-Präsident Chávez parastaatliche Milizen aufrüstete, um die Opposition zu bekämpfen.
20 Jahre Chávez

Die Herunterwirtschaftung und Entdemokratisierung Venezuelas geschah nicht von einem Tag auf den anderen. Vor 20 Jahren, am 6. Dezember 1998, gewann Hugo Chávez die Präsidentschaftswahl in Venezuela, proklamierte die „bolivarische Revolution“ und den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“. Er versprach, die Armut auszuradieren, durch Umverteilung, Verstaatlichungen sowie Investitionen in Bildung und Gesundheit – kombiniert mit einem populistischen Personenkult.

Alois Heigl, der damals in der Nähe der Hauptstadt Caracas lebte, berichtete in seiner Radiosendung kritisch über den neuen starken Mann. Kurz darauf wurde er festgenommen und drei Wochen eingesperrt, ohne Kontakt zur Außenwelt. „Bereits damals wusste ich: Venezuela geht vor die Hunde“, sagt Heigl heute. Das sahen die meisten von Heigls venezolanischen Freunden damals anders, sie waren angetan vom neuen Präsidenten, der so viel frischen Wind in die Politik brachte.
Und viele Anhänger auf der ganzen Welt waren davon überzeugt, Chávez würde durch seine groß aufgezogenen Sozialprogramme Venezuela gerechter machen. So brandete ihm auch in Wien viel Jubel entgegen, als er die Stadt für den EU-Lateinamerika-Gipfel 2006 besuchte. Bei Auftritten vor diversen Solidaritätsgruppen wurde er wie ein Popstar mit Standing Ovations empfangen. Sabine Kurtenbach, die kommissarische Direktorin des GIGA Instituts für Lateinamerika-Studien in Hamburg, stritt sich schon damals mit begeisterten Kollegen über den venezolanischen Staatschef: „Der ‚Sozialismus des 21. Jahrhunderts’ ist nicht mehr als ein Etikett, das sich Chávez aufgeklebt hat, um sich von anderen abzusetzen. Chávez ist von der Linken in der ganzen Welt zum Teil heroisiert worden, aber er war vor allem ein Populist wie andere auch“, sagt sie.
Chávez badete unter anderem bei einem Auftritt in der Wiener Urania strahlend in der Menge und verkündete daraufhin sein Vertrauen in Gott und Fidel Castro. Darüber hinaus konnte Chávez aber in seiner Amtszeit vor allem auf den stetig steigenden Ölpreis, der sich von seinem Wahlsieg 1998 bis zu seinem Tod 2013 mehr als verzehnfachte, vertrauen. Die Einnahmen aus dem Rohölexport sprudelten.
Bereits der in den 1970er Jahren regierende Präsident Carlos Andrés Pérez hatte die Erdölförderung verstaatlicht – damals zählte Venezuela zu den 20 reichsten Ländern der Welt. Chávez ging jedoch noch anderthalb Schritte weiter. Nach einem zweieinhalbmonatigen Streik von Mitarbeitern des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA gegen seine Politik im Jahr 2002 rächte sich der von den staatlichen Medien und Anhängern als „Comandante“ gepriesene Chávez und entließ die Hälfte der Belegschaft, 18.000 Personen, und verunglimpfte sie als „Staatsfeinde“. Unersetzbares Know-how ging damit verloren. Internationale Unternehmen zogen sich daraufhin mitsamt ihren Technologien zurück. Die Aufbereitung des sandhaltigen Schweröls fiel der PDVSA aufgrund mangelnder Technologie und fehlenden Fachwissens nun immer schwerer.
Von den Öleinnahmen wurden gleichzeitig große Teile veruntreut. Der venezolanische Ökonom und Oppositionelle José Guerra sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass seit Chávez’ Machtantritt mehr als 1.000 Mrd. Dollar aus dem Erdölexport ins Land geflossen sei. „Wäre die Geschichte anders verlaufen, könnte Caracas heute wie Dubai aussehen, eine Stadt mit Wolkenkratzern der Superlative“, schreibt die Zeitung dazu – doch statt sich in Richtung Himmel auszustrecken, liegt Venezuela heute am Boden.
Die aggressive Verstaatlichungsstrategie betraf dabei nicht nur die Ölindustrie, hunderte Betriebe etwa aus der Stahl- und der Zementindustrie wurden genauso verstaatlicht wie die gesamte Strom- und Nahrungsmittelversorgung. Damit verschreckte Chávez nicht nur ausländische Investoren, auch inländische Firmen eröffneten fortan aus Angst vor Enteignungen keine neuen Fabriken mehr und investierten kaum noch in neue Anlagen. Viele Menschen verloren dadurch ihre Jobs. Die Schuld für die Misere suchten Chávez und seine Anhänger stets bei den USA und bei venezolanischen Großunternehmern, die angeblich von Miami aus nach einer Destabilisierung Venezuelas trachteten.
Kontinentales Beben
Die venezolanische Krise beschäftigt auch aufgrund der großen Anzahl an Fliehenden mittlerweile ganz Südamerika. „Mit der Flüchtlingskrise ist Kolumbien bisher beispielhaft umgegangen, und es bleibt zu hoffen, dass es trotz enormer Belastungen so bleibt. Denn obwohl große Bevölkerungsteile Kolumbiens selbst arm sind, werden die Flüchtlinge aus Venezuela mit offenen Armen empfangen“, sagt der Wirtschaftsdelegierte Hörtnagl. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in vielen Ländern Südamerikas, auch in Kolumbien, die Situation sehr angespannt ist und die hohe Zahl an venezolanischen Flüchtlingen mehr und mehr als Bürde betrachtet wird. So hat Brasilien Militär an die Grenzen verlegt, und Peru fordert neuerdings zur Einreise einen Reisepass, den viele Venezolaner nicht besitzen – zuvor reichte ein Personalausweis.

Die Organisation Amerikanischer Staaten schließt mittlerweile sogar einen gewaltsamen Sturz Maduros durch eine Militärintervention nicht mehr aus. Sabine Kurtenbach greift sich an den Kopf, wenn sie von diesen Überlegungen spricht. „Wer soll das machen? Zudem stärken solche Aussagen doch nur das Regime.“ Sie beobachtet auf dem ganzen Kontinent eine große Polarisierung: „Ich habe das Gefühl, ich sei zurückkatapultiert in die 1980er Jahre, als die ideologischen Fronten so stark waren. Da wird von der venezolanischen Seite und deren Unterstützern Nicaragua, Bolivien und einigen karibischen Staaten, Kritik automatisch als ideologisch motiviert verunglimpft – und die Gegenseite spielt es dann genau andersherum. Es verbarrikadieren sich alle in ihren Schützengräben.“
Maduros Lebensversicherung
Im vergangenen Jahr starben in Venezuela bei Protesten gegen die Regierung mehr als hundert Menschen. Dass es in dieser Hinsicht zuletzt ruhiger geworden ist, liegt weniger an einer Verbesserung der Situation als daran, dass sich für die meisten Venezolaner der Alltag nur noch ums nackte Überleben dreht. Viele Menschen sind zudem von Lebensmittelzuweisungen durch die Regierung abhängig. „Solange die Opposition gespalten ist und es das Sicherheitsventil der Flucht gibt, organisiert sich da auch wenig. Dazu kommt die Unterstützung von China und Russland, die dem Regime wirtschaftlich das Überleben ermöglicht“, sagt Kurtenbach. Erst kürzlich gewährte die chinesische Entwicklungsbank dem staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA wiederum ein Darlehen über fünf Mrd. Dollar – in den vergangenen zehn Jahren hat China dem Land rund 60 Mrd. Dollar geliehen. Sabine Kurtenbach glaubt, dass es in Venezuela also „noch eine ganze Weile so weiter geht“.

Auf dem Rückweg vom letzten China-Besuch Mitte September machte Maduro in Istanbul Halt. Ein Video zeigt ihn dort in einem Nobelrestaurant, Steak essend und Zigarre rauchend. „Man lebt nur einmal“, kommentiert der Präsident den Abend. Das Video schlug in Venezuela hohe Wellen. „Das kommt nicht gut, wenn die eigenen Leute hungern. So etwas kann der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt“, sagt Kurtenbach. Alois Heigl glaubt nicht daran. Zu viele Venezolaner, die dem Regime etwas entgegensetzen könnten, haben das Land bereits verlassen. Er selbst besuchte seine Heimat das letzte Mal vor acht Jahren. Nachdem seine Cousine auf offener Straße erschossen wurde, schloss er weitere Aufenthalte in Venezuela vorerst aus, hält nur noch telefonisch und per E-Mail Kontakt: „Zu den fünf Prozent meiner Freunde, die noch da sind, die das Land noch nicht verlassen haben.“