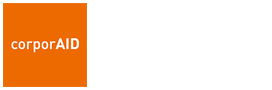Von Eva Plank
Für Kleinbauern südlich der Sahara ist der Alltag von vielen Unsicherheiten geprägt. Wann soll gesät werden? Wie viel Düngemittel wird benötigt? Und wann ist der beste Zeitpunkt zur Bewässerung? Tradition und Erfahrung dienen zwar als Orientierung, sind aber angesichts des Klimawandels zunehmend nicht genug. Unerwartete Trockenperioden oder heftige Regenfälle können Saatgut und ganze Ernten zerstören – mit existenzbedrohenden Folgen.
Moderne Technologien können diese Risiken künftig verringern. Das österreichische Unternehmen Pessl Instruments bringt aktuell „100.000 Weather Stations for Africa“ ins Rollen, ein Projekt, das Kleinbauern präzise Wetterdaten liefern und ihre Landwirtschaft damit ertragreicher und widerstandsfähiger machen soll. Die dafür notwendigen Wetterstationen und anderen Sensoren werden über ein Operational-Leasing-Modell finanziert: Die Landwirte zahlen jährlich eine Gebühr, die die Nutzung der Hardware, aber auch die dazugehörigen Dienstleistungen wie Software und Support abdeckt. Die Geräte bleiben im Besitz von Pessl Instruments und werden über die Leasing-Einnahmen refinanziert. Die Hürde hoher Anschaffungskosten – derartige Wetterstationen kosten je nach Funktion im Direktverkauf zwischen 400 und 4000 Euro – kann so umgangen werden.
Vom Boden in die Cloud
Doch wie führen diese Technologien zu höheren Erträgen? Wetterstationen und Sensoren liefern Landwirten präzise Daten über Bodenfeuchtigkeit, Regenwahrscheinlichkeit und bevorstehende Wetterereignisse. Zusätzlich können Messgeräte den Stickstoffgehalt in den Pflanzen überwachen und so helfen, den Düngemitteleinsatz zu optimieren. Über eine Handy-App können die Landwirte auf diese Informationen zugreifen und ihre Entscheidungen entsprechend anpassen. Die App gibt zwar keine konkreten Handlungsempfehlungen, stellt aber notwendige Daten bereit, auf deren Grundlage die Landwirte fundierte Entscheidungen treffen können. Sagt die App etwa zwei Wochen Trockenheit vorher, kann sich der Landwirt auf Basis dieser Information dazu entscheiden, mit der Aussaat seines Getreides noch abzuwarten, und so einem Ernteausfall entgegenwirken. Die Technologien haben das Potenzial, nicht nur Ernteerträge zu steigern, sondern Subsistenzwirtschaften in produktive, exportfähige Betriebe zu verwandeln.
Von Weiz in die Welt
Die Idee für dieses Projekt kommt aus Weiz, einer 12.000 Einwohner-Stadt in der Steiermark. Dort gründete Gottfried Pessl 1984 das Unternehmen Pessl Instruments. Unter der Marke „METOS by Pessl Instruments“ vertreibt das Unternehmen weltweit seine Geräte, um Bauern zu helfen, ihre wetter-, wasser- und umweltbedingten Risiken in der Landwirtschaft zu reduzieren.
Pessl Instruments ist global aktiv, mit einem Netzwerk an Partnern und Kunden in über 85 Ländern. Das Unternehmen ist neben der Landwirtschaft auch in den Bereichen Forschung, Umweltmanagement und Logistik tätig. In Afrika ist Pessl Instruments seit den 1990er-Jahren unterwegs. In Südafrika stehen bereits über 5.000 Wetterstationen. Auch Ägypten kaufte schon vor 15 Jahren erste Geräte des Unternehmens.
Nun soll das Engagement aber deutlich ausgeweitet werden. Basis bleibt die Technologie, doch Geschäftsführer Pessl will das Angebot um eine umfassende Beratung ergänzen. Während in den meisten Ländern Europas öffentliche Einrichtungen, wie in Österreich etwa die Landwirtschaftskammer, Beratungen für Landwirte bereitstellen, würden solche Angebote in weiten Teilen Afrikas fehlen. „Es ist eine Idee, die ich schon lange mit mir herumtrage“, sagt Pessl über das Vorhaben, Kleinbauern nicht nur mit Technologie, sondern auch mit Wissen und Unterstützung auszustatten – und ihnen dadurch den Zugang zu europäischen Märkten zu erleichtern.

Geteilte Aufgaben
Um den Kleinbauern in Subsahara-Afrika den Zugang zu diesen Technologien zu ermöglichen, hat Pessl Instruments ein mehrgliedriges Konzept entwickelt. Zunächst muss die technische Infrastruktur in Betrieb genommen werden. Die Geräte sammeln Daten über lokale Wetterbedingungen, Bodenzustand und Pflanzennährstoffe. Die Landwirte können diese Informationen über die App ClimateField abrufen, die in 27 Sprachen verfügbar ist. Auch die Bezahlung der in Anspruch genommenen Dienstleistungen kann direkt über die App erfolgen.
Die Implementierung und Instandhaltung der Technologien übernehmen lokale Partnerunternehmen, die in das Projekt investieren. Gottfried Pessl betont, er wolle in Afrika nicht als europäischer Oberlehrer auftreten. Deshalb habe er beschlossen: „Die lokalen Unternehmen sind im Joint-Venture mehrheitsbeteiligt, und sämtliche Mitarbeitende sind lokale Kräfte.“ Der zweite zentrale Baustein neben der technologischen Umsetzung ist die persönliche Beratung durch sogenannte Digital Farm Advisors. Diese Berater sollen die Vermarktung der Geräte unterstützen und sicherstellen, dass sie effektiv genutzt werden.

Das Wissen bleibt in den Dörfern
Die Digital Farm Advisors sind das Bindeglied zwischen den Technologien und den Bauern in den Dörfern. Ihre Aufgabe ist es, den Landwirten die Nutzung der App und der Geräte näherzubringen. Davor gilt es aber erst einmal das Vertrauen der lokalen Bevölkerung zu erlangen und diese davon zu überzeugen, dass die Investition in diese Technologie sinnvoll ist. Viele Bauern nutzen günstiges, wenig ertragreiches Saatgut, da das Risiko von Ernteausfällen hoch und teures Saatgut schwer zu rechtfertigen ist. Präzise Daten zu optimalen Aussaat- und Düngungsbedingungen helfen, das Risiko von Verlusten zu verringern, wodurch der Einsatz leistungsstärkerer Sorten möglich wird. Diese können unter idealen Bedingungen Erträge von bis zu 15 Tonnen Mais pro Hektar statt nur drei Tonnen liefern, so Pessl. Der wirtschaftliche Nutzen zeigt sich in den meisten Fällen bereits nach einer Erntesaison.
Das Projekt ist darauf ausgerichtet, dass sich Kleinbauern zu Kooperativen zusammenschließen, um die Technologien gemeinsam zu nutzen. Während die Geräte gemeinschaftlich betrieben werden, kann jeder Landwirt die erhobenen Daten individuell für seine Planung einsetzen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es auch Kleinbetrieben, die nur eine Fläche von etwa 0,15 bis 0,35 Hektar bewirtschaften, Zugang zu moderner Technologie zu erhalten. Eine eigene Wetterstation für jeden Landwirt sei ohnehin nicht notwendig, sagt Pessl. Durch solche Zusammenschlüsse können Kleinbauern nicht nur effizienter wirtschaften, sondern auch über die reine Selbstversorgung hinausgehen und wettbewerbsfähige Produkte erzeugen. Der Digital Farm Advisor spielt hierbei eine zentrale Rolle, indem er sicherstellt, dass diese Kooperativen das nötige Training erhalten und gut zusammenarbeiten.
Die Suche nach lokalen Beratern ist jedoch herausfordernd. Sie sollen aus dem jeweiligen Dorf stammen, um die Lebensrealitäten der Bauern tatsächlich zu verstehen und sind idealerweise junge Dorfbewohner, die nach dem Studium in der Stadt aufs Land zurückkehren und ihr Wissen einbringen. Um geeignete Kandidaten zu finden, plant Pessl Instruments Recruiting-Sessions in Dörfern und gezielte Anfragen an Universitäten. Die ausgewählten Personen werden anschließend durch Online-Schulungen zu Digital Farm Advisors ausgebildet

Geldgeber für das Projekt
Das größtenteils privatwirtschaftlich finanzierte Projekt soll auf mehreren Beinen stehen. Zum einen soll es durch staatliche und internationale Förderungen abgesichert werden. Zudem arbeitet Pessl an einer Finanzierungslösung mit der Oesterreichischen Entwicklungsbank OeEB. Der Schlüssel zur Umsetzung des Projektes seien aber die lokalen Joint-Venture-Partner, die zu Beginn mindestens 500.000 Euro investieren müssen. Namen von künftigen Partnern nennt der Geschäftsführer nicht. In Betracht kommen große Unternehmen aus dem landwirtschaftlichen Sektor, wie Pflanzenschutz-, Maschinen- und Düngemittelhändler, die bereits über etablierte Netzwerke vor Ort verfügen und die Wetterstationen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen effizient in ihren Ländern vertreiben können.
Rentiert sich das für die Investoren? Pessl ist überzeugt, dass es das bereits nach ein bis drei Jahren tun wird: „Der Markt in Afrika ist riesig. Es gibt dort rund 300 Millionen Kleinbauern, und selbst wenn wir nur zehn Prozent davon erreichen, ist das ein enormes Geschäftspotenzial.“ Der Wunsch ist, die laufenden Kosten für die Landwirte möglichst niedrig zu halten. Sie liegen bei einer Höhe von 50 bis 100 Euro pro Jahr, abhängig von Faktoren wie der Größe der Anbaufläche und der Mitgliederzahl der Kooperativen. Pessl geht davon aus, dass Institutionen wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) oder die U.S. Agency for International Development (USAID) Interesse an diesem Projekt haben könnten: „Wenn etwa die GIZ ein Dorf in Kenia unterstützt, indem sie finanzielle Mittel zur Förderung der Landwirtschaft bereitstellt und lokale förderwürdige Projekte gesucht werden, dann können wir der GIZ unser Konzept anbieten.“
Dass die Landwirte immer zumindest einen kleinen finanziellen Anteil selbst leisten, ist für Pessl ein Grundgesetz. Würde es sie nichts kosten, sänke womöglich auch das Interesse an der Instandhaltung der Messgeräte. „Sie müssen auch den wirtschaftlichen Schmerz fühlen, was mit ihrer Ernte passiert, wenn sie die Wetterstation nicht entsprechend schützen“, ergänzt Emile Jordaan, der den Südafrika-Standort von Pessl Instruments leitet.
Start für Ernährungssicherheit
Pessl Instruments hat eine umfassende Analyse durchgeführt, um zu ermitteln, welche Früchte in welchen afrikanischen Ländern angebaut werden können. Die Untersuchung konzentrierte sich auf Landwirte, die ihre Produkte nach Europa exportieren möchten. Dabei wurden Kriterien wie Marktgröße oder Marktzugänglichkeit berücksichtigt.
Aus den 54 afrikanischen Staaten entstand eine Shortlist von 15 Zielländern, in denen das Projekt umgesetzt werden soll. Zu den priorisierten Ländern zählen agrarisch starke Regionen mit hoher Bevölkerungsdichte und bedeutendem Exportpotenzial, darunter Kenia, Nigeria, Algerien, Ghana, die Elfenbeinküste, Senegal, Uganda, Ruanda und Mosambik. Diese Länder bieten die besten Voraussetzungen, um den Agrarsektor zu stärken sowie die Ernährungssicherheit zu fördern, während zugleich neue Exportmärkte erschlossen werden.
Gottfried Pessl rechnet mit dem Start des Projekts im Februar 2025. Beginnen möchte er in Kenia. Danach sollen Ghana und die Elfenbeinküste folgen. Und in der südafrikanischen Provinz Ostkap hat sich bereits eine Gruppe an Landwirten zusammengefunden, die gerne eine Wetterstation installieren möchten. Emile Jordaan will nun mithilfe lokaler Organisationen wie Agri South Africa Verbindungen zu den lokalen Communities aufbauen. „Das Ziel ist nicht, einfach eine Wetterstation aufzustellen, um die bestehende Subsistenzwirtschaft zu unterstützen. Vielmehr sollen Kleinbauern dabei unterstützt werden, dass sie über die reine Selbstversorgung hinausgehen und aktiv zur Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit ihres Landes beitragen“, erklärt Jordaan.
Afrika verfüge über die notwendigen Ressourcen und das Potenzial, ernährungssicher zu werden – davon ist der Leiter von Pessl Instruments Südafrika überzeugt. Beim Ausschöpfen dieses Potenzials wolle man mit diesem Projekt mithelfen.