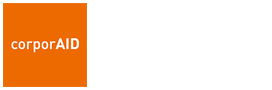Wie würden Sie Japans Entwicklungspolitik kurz charakterisieren?
Klingebiel: Japan war immer ein Top-Geber – lange die Nummer zwei nach den USA, heute die Nummer vier –, und zugleich ein besonderer Geber. Denn Japan verfolgte immer ein Entwicklungsmodell, das stark auf den eigenen Entwicklungserfahrungen aufbaut und dem eigenen Land zugute kommt. Das zeigt sich beispielsweise in einem starken Fokus auf Transportinfrastruktur und Energie und einem geringen Fokus auf wenig entwickelte Länder. In den einschlägigen Indizes zum Entwicklungsengagement finden wir Japan in der Folge dann auch auf den hinteren Plätzen. Das mag damit zu tun haben, dass diese Indizes eher der Logik starker anglophoner Akteure folgen, dennoch sollte sich Japan im internationalen Diskurs über gute Praktiken von Entwicklungszusammenarbeit etwas stärker aufstellen.
Japan setzt stark auf die Kooperation mit der eigenen Wirtschaft.
Klingebiel: Das halte ich erst einmal für sinnvoll, weil öffentliche Mittel allein nicht ausreichen. Wenn es aber stark darum geht, dem eigenen Privatsektor Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, und dies letztlich zu Nachteilen der Partnerländer führt – weil nicht international ausgeschrieben wird und Dienstleistungen oder Waren dann vergleichsweise teurer sind –, sollte das auch diskutiert und kritisiert werden. Dafür gibt es die Foren und Peer Reviews des Entwicklungshilfeausschusses DAC der OECD, an dessen Gründung Japan Anfang der 1960er Jahre selbst beteiligt war. Japans Entwicklungszusammenarbeit steht heuer übrigens planmäßig wieder ein Peer Review bevor.
Japan argumentiert, dass die Entwicklungszusammenarbeit durch ihren Nutzen den Rückhalt der Bevölkerung erhält.
Klingebiel: Das gilt für alle Geberländer, und Japan ist mit seiner Praxis nicht allein. Auch in Großbritannien und in den USA gibt es derzeit höheren Druck, die nationalen Interessen stärker zu betonen. Doch sollten wir uns gleichzeitig darauf verständigen, dass es auch ein gemeinsames Interesse gibt, Mittel, so gut es geht, im entwicklungspolitischen Sinn einzusetzen.
Japans Agentur für internationale Zusammenarbeit JICA vereinigt die technische und finanzielle Zusammenarbeit unter einem Dach. Ist das zukunftsweisend?
Klingebiel: Die Zusammenführung der drei Instrumente Schenkung, Kredite und technische Zusammenarbeit ist ein interessanter und innovativer Aspekt, der eine konsistente und kohärente Entwicklungszusammenarbeit fördert. Ein Trend in diese Richtung ist international erkennbar. Dabei geht das Mandat der JICA über Entwicklungszusammenarbeit hinaus. Die JICA ist eine Agentur, die internationale Kooperation an sich macht. Und es gibt gute Gründe zu sagen, dass das vielleicht auch die moderne Form ist, Entwicklungszusammenarbeit zu organisieren. Die Zuständigkeit einer solchen Agentur ist dann nicht davon abhängig, ob ein Partner auf der Entwicklungsländerliste steht oder nicht, sondern ob man aus Gründen der globalen nachhaltigen Entwicklung mit diesem Land zusammenarbeiten will. Immer mehr Länder – demnächst die Türkei, Indien und China – werden von der Liste genommen. Ich halte es für einen Vorteil, mit diesen Ländern weiter kooperieren zu können.
Wie arrangieren sich China und Japan als Akteure der Entwicklungszusammenarbeit?
Klingebiel: Sie sind unvergleichbar, allein was das Volumen betrifft. China hat nun aber auch schon eine eigene Agentur für Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein Meilenstein. Japan hat jedenfalls Interesse daran, mit China im Dialog zu sein, etwa beim Angebot von Fort- und Ausbildung.
Das JICA-Research Institut ist ein bekannter Think Tank. Wo liegen die Schwerpunkte?
Klingebiel: Wir kooperieren selbst regelmäßig mit dem JICA Research Institut, das vor allem zu integrativer und menschlicher Entwicklung sehr viel anzubieten hat.
Vielen Dank für das Gespräch!