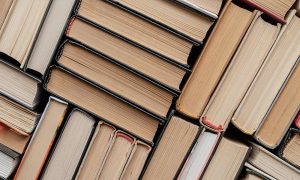Autor: Klaus Huhold
Fragen wie die Förderung des globalen Wohlstands oder die Gestaltung der Beziehungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern stehen seit Jahrzehnten im Zentrum kontroverser Debatten. Dabei spielen Thinktanks, auch als Denkfabriken bekannt, eine zentrale Rolle. Einrichtungen wie Chatham House in London, das Institut Français des Relations Internationales in Paris oder die Brookings Institution in Washington gehören zu den bedeutendsten ihrer Art. Sie vereinen Expertinnen und Experten aus Politikwissenschaft, Ökonomie, Soziologie und anderen Fachbereichen, um komplexe entwicklungspolitische Fragen zu analysieren und Lösungsansätze zu entwickeln. Zu den heißen Themen zählen aktuell Klimapolitik, Migration oder Urbanisierung. Thinktanks veröffentlichen regelmäßig fundierte Studien und Thesen dazu.
Im deutschen Sprachraum haben wir mit dem German Institute of Development and Sustainability (IDOS) einen entwicklungspolitischen Thinktank, der in internationalen Rankings regelmäßig Top-Platzierungen belegt. Dieses Jahr feiert er sein 60-jähriges Bestehen. Bei seiner Gründung trug er noch den Namen Deutsches Institut für Entwicklungspolitik – die Namensänderung spiegelt die zunehmende Internationalisierung und das gewandelte Selbstverständnis der Einrichtung wider.
Global vernetzt
„Das Institut war vor 60 Jahren und über Jahrzehnte hinweg ein recht kleines Institut, das vor allem deutsche Akteure beraten hat“, erklärt Axel Berger, stellvertretender Direktor des IDOS und seit 2007 Teil des Instituts. „Heute beschäftigen wir 180 Mitarbeitende, von denen zwei Drittel wissenschaftlich tätig sind. Unsere Kolleginnen und Kollegen kommen aus 40 Ländern und forschen sowohl bei uns als auch mit uns.“
Von der Förderung grüner Industrien bis zum verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz bearbeitet IDOS die verschiedensten Themen. Dennoch bleibt das übergeordnete Ziel stets gleich, wie Berger erklärt: „Wir wollen Entwicklungspolitik konkret mitgestalten und damit weltweit für eine nachhaltigere Zukunft sorgen.“
Um den Transfer seiner Forschungsergebnisse in die Praxis abzusichern, pflegt IDOS einen engen Austausch mit politischen Entscheidungsträgern und relevanten Institutionen: Ministerien, regionale und internationale Organisationen, NGOs und andere Thinktanks. Die Zusammenarbeit erfolgt auf vielfältige Weise: formell, etwa durch Konferenzen, oder informell, beispielsweise bei einem Abendessen. Diese Netzwerke, die das Institut über Jahre hinweg aufgebaut hat, sind essenziell, um Impulse für eine nachhaltige Entwicklungspolitik zu setzen.
Akteure mit Impact
Der Einfluss von Thinktanks wird jedoch – je nach Perspektive – nicht immer nur positiv gesehen. Besonders in den 1990er Jahren flammten hitzige Diskussionen über die „Macht“ solcher Denkfabriken auf. Damals spielten US-amerikanische Denkfabriken wie die Heritage Foundation und das American Enterprise Institute eine zentrale Rolle bei der Ausarbeitung und Verbreitung des sogenannten Washington Consensus. Dieser beinhaltete Empfehlungen für die wirtschaftliche Entwicklung von Schwellen- und Entwicklungsländern, darunter Marktöffnungen, Handelsliberalisierungen und fiskalische Disziplin. Die enge Zusammenarbeit dieser Thinktanks mit der US-Regierung, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) – allesamt in Washington ansässig – führte dazu, dass der Washington Consensus als Leitlinie für Strukturanpassungsprogramme und Kreditvergaben des IWF etabliert wurde.
Wie erfolgreich diese Reformen waren, ist bis heute umstritten und hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten in den betroffenen Ländern ab. Der Ökonom und Politologe Enrique Mendizabal, selbst aus Peru stammend, hebt hervor, dass solche Reformen in seinem Heimatland mehr Wirkung entfalten hätten können, wenn die Stärkung der Institutionen mehr berücksichtigt worden wäre. „Wir haben noch immer eine schwache Justiz und ein schwaches Parlament“, erklärt er.
Gleichzeitig betont Mendizabal, dass Peru diese Reformen eigenständig beschlossen habe: „Die Politiker wussten, worauf sie sich einlassen, und ein Großteil der Öffentlichkeit forderte Anfang der 1990er Jahre solche Maßnahmen. Zu behaupten, wir seien hier ein Opfer gewesen, ist paternalistisch.“
Interview mit Enrique Mendizabal
Nutzen bieten
Der Entwicklung voraus
Enrique Mendizabal, der in Barcelona die Plattform „On Think Tanks“ gegründet hat, sieht die Aufgabe von Denkfabriken darin, praxistaugliche Analysen und Konzepte bereitzustellen. „Sie müssen für ihr Publikum relevant und für Entscheidungsträger aus Politik, Verwaltung oder der Wirtschaft nützlich sein“, betont er. Das koppelt sie auch an aktuelle Diskussionen und Prozesse: Wenn etwa die EU-Kommission den Green Deal als Leitgedanken auch für ihre Beziehungen zu Entwicklungs- und Schwellenländern verankert, schlägt sich dies auch in den Themenlisten europäischer Denkfabriken nieder.
Axel Berger von IDOS betont demgegenüber, dass der Anspruch seines Instituts über die Reaktion auf politische Entwicklungen hinausgehe: „Wir versuchen, immer ein Stück vorauszudenken und Themen, die an Bedeutung gewinnen werden, frühzeitig zu identifizieren.“ Als Beispiel nennt er die Erforschung der Rolle ausländischer Direktinvestitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu einem Zeitpunkt, als die entsprechenden Verhandlungen in der Welthandelsorganisation (WTO) über Erleichterungen solcher Geldflüsse noch in den Anfängen waren. Um den Diskurs fundiert mitzugestalten, entwickelte IDOS einen Investment Facilitation Index zur Messung der bisherigen Bemühungen von Ländern um Direktinvestitionen. Auf dieser Basis wurden wirtschaftliche Simulationen erstellt, die zeigten, welche Länder von einem solchen Abkommen profitieren könnten. Zusätzlich forschte IDOS vor Ort in Laos, Sambia und Togo und führte Gespräche mit Vertretern internationaler Institutionen wie der WTO und den Botschaften einer Reihe von Ländern. Parallel dazu führte das Institut Vertreter aus dem globalen Süden zusammen – darunter Ministerialbeamte, Investitionsagenturen und Wissenschafter.
„Unser Ziel war es, Niedrig- und Mitteleinkommensländern auf Grundlage unserer Forschung und Netzwerke eine bessere Verhandlungsposition zu verschaffen“, sagt Berger. Denn auch das sieht IDOS als seine Aufgabe an: seine über die Jahrzehnte aufgebauten Beziehungen zu internationalen Organisationen, der EU oder der deutschen Regierung auch Partnern in den Entwicklungsländern zugänglich zu machen, damit sie ihre Stimme einbringen können.

Spiegel der politischen Kultur
Wie Thinktanks arbeiten, beraten und sich in der Öffentlichkeit positionieren, ist stark von ihrem Standort geprägt, erklärt Enrique Mendizabal: „In Großbritannien und den USA agieren Thinktanks oft dynamischer, vertreten häufiger bestimmte Interessen und widmen sich kurzfristigen Projekten. In Europa hingegen sind sie tendenziell akademischer geprägt.“ In diesen Unterschieden spiegle sich die jeweilige politische Kultur wider. „In den USA ist das Zwei-Parteien-System sehr konfrontativ.
Auch im britischen Parlament sitzen sich die politischen Gegner als klare Streitparteien gegenüber“, so Mendizabal. In Kontinentaleuropa hingegen sei die Politik stärker darauf ausgerichtet, einen Konsens zu finden und Koalitionen zu schmieden. „Diese Mentalität beeinflusst auch die Art und Weise, wie Thinktanks forschen und kommunizieren.“
Eine wichtige Rolle komme zudem der Finanzierung zu. Europäische Thinktanks, insbesondere im entwicklungspolitischen Bereich, werden häufig durch öffentliche Mittel unterstützt. Diese staatliche Förderung ermögliche langfristige Forschungsprojekte. In den USA und Großbritannien hingegen finanzieren sich Thinktanks stärker über private Gelder – etwa von Unternehmen, Stiftungen oder Philanthropen.
In diesem Umfeld betreiben sogar große Beratungsfirmen wie die Boston Consulting Group oder McKinsey eigene Thinktanks, die sich beispielsweise mit Marktpotenzialen in Entwicklungs- und Schwellenländern befassen.
Auf die Frage, inwieweit der wohlhabendere Norden im Thinktank-Kosmos die Themenführerschaft übernehme, stellt Axel Berger vom German Institute of Development and Sustainability (IDOS) klar: „Es ist unser Anspruch, gleichberechtigte Forschungspartnerschaften aufzubauen und so mit den Partnerländern und nicht über sie zu forschen.“ Kooperation auf Augenhöhe – die Wissenschaft geht voran.

Fotos: Chatham House, Idos, OnThinkTanks
Übersicht
Europas größte Thinktanks für Entwicklungspoltiik
Institute of Development Studies
Großbritannien
Jahresbudget: 35 Millionen Euro.
Finanzierung: Britische und internationale Regierungsstellen, Forschungskooperationen, Einnahmen aus Lehrprogrammen
Schwerpunkte: Armutsbekämpfung, globale Ungleichheit und Umweltpolitik
Chatham House
Großbritannien
Jahresbudget: 25 Millionen Euro
Finanzierung: Stiftungen, Regierungsorganisationen, Mitgliedsbeiträge, Projektpartnerschaften
Schwerpunkte: Internationale Wirtschaft und Entwicklungsfinanzierung, Konflikte und Governance, Gesundheit und Ernährungssicherheit
German Institute for Development Studies (IDOS)
Deutschland
Jahresbudget: 19 Mio. Euro
Finanzierung: Institutionelle Förderung, dt. Ministerien, regionale und internationale Organisationen
Schwerpunkte: Umwelt-Governance, Transformation von Wirtschafts- und Sozialsystemen, Transformation von Politischen Ordnungen
Danish Institute for International Studies
Dänemark
Jahresbudget: 13 Millionen Euro
Finanzierung: Dänische Regierung, EU und internationale Förderer wie Entwicklungsbanken
Schwerpunkte: Internationale Konflikte, Klimapolitik, Migrationsdynamiken
European Centre for Development Policy Management
Niederlande
Jahresbudget: 9,1 Millionen Euro
Finanzierung: Niederländische Regierung, EU, europäische Entwicklungsagenturen
Schwerpunkte: Entwicklungspolitik der EU-Staaten mit Fokus auf Migration, Klimawandel und Ernährungssicherheit
Institut Français des Relations Internationales
Frankreich
Jahresbudget: 8,4 Millionen Euro
Finanzierung: Unternehmen, Stiftungen, Regierungsstellen und internationale Kooperationen
Schwerpunkte: Global Governance, Energiepolitik, neue Technologien