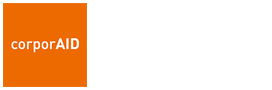09.04.2020 Die COVID-19-Pandemie hat sich inzwischen zu einer globalen Herausforderung entwickelt. Laut António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen VN, handelt es sich um „den größten Test für die Menschheit seit Gründung der Vereinten Nationen 1945“. Während das Coronavirus schon jetzt die vergleichsweise gut aufgestellten Gesundheits- und Wirtschaftssysteme einiger Industrienationen vor enorme Probleme stellt, sehen die Prognosen für Entwicklungsregionen umso düsterer aus. Denn in ärmeren Ländern mit deutlich fragileren Infrastrukturen dürfte sich das Virus noch schwerer eindämmen lassen: Selbst einfache präventive Maßnahmen wie richtiges Händewaschen sind aufgrund von Wassermangel und fehlender Seife oft nicht durchführbar, Strategien wie Homeoffice und soziale Distanz für Bewohner dicht besiedelter Slums fern jeder Umsetzbarkeit.
Nicht minder beunruhigend, drohen noch dazu „beispiellose wirtschaftliche Schäden“, wie es in einem neuen Bericht der VN-Organisation für Handel und Entwicklung UNCTAD heißt. Schon seit zwei Monaten seien Entwicklungsländer unter anderem mit Kapitalabflüssen, sinkenden Erlösen aus dem Export von Rohstoffen und ausbleibenden Touristen konfrontiert. Und anders als Industrieländern fehlt es ärmeren Staaten an Geld für wirtschaftliche Hilfspakete, warnt UNCTAD-Generalsekretär Mukhisa Kituyi. Eine aktuelle Studie der Afrikanischen Union schätzt, dass das Import- und Exportvolumen auf dem Kontinent um 35 Prozent einbrechen wird, das würde einem Handelsverlust von etwa 270 Milliarden Dollar entsprechen. Gleichzeitig werden die öffentlichen Ausgaben im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus in Afrika um mindestens 130 Milliarden Dollar steigen.
Großzügige Hilfe muss wohl von außen kommen. Weltbank-Präsident David Malpass kündigte bereits an, bis zu 160 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von 15 Monaten bereitzustellen. Dies soll die „Fähigkeit von Schwellen- und Entwicklungsländern stärken, mit der Pandemie umzugehen, und die Dauer einer wirtschaftlichen und sozialen Erholung zu verkürzen“, erklärte er. In einem ersten Schritt wurden bereits 1,9 Milliarden Dollar an 25 Länder, darunter Indien, Pakistan, Afghanistan und Äthiopien, freigegeben.
Die Vereinten Nationen fordern indes die globale Umsetzung des aktuellen „Whatever it takes“-Mindset in Form eines gigantischen 2.500 Milliarden Dollar-Hilfspakets: 1.000 Milliarden Dollar sollen als Liquiditätsspritze Entwicklungsländer stützen, weitere 1.000 Milliarden als Schuldenerlässe gewährt werden sowie 500 Milliarden Dollar in einen Marshall-Plan für Gesundheit fließen. Dass die Regierungen dieser Welt angesichts eigener Herausforderungen solche Summen mobilisieren werden, scheint allerdings illusorisch.
Wie konkret Europas Unterstützung für Afrika aussehen kann, wollen wiederum die EU-Entwicklungsminister in den nächsten Tagen entscheiden. Gerade die Europäische Union, die erst vor wenigen Wochen eine neue EU-Afrika-Strategie mit verstärkter Kooperation zwischen den Kontinenten angekündigt hat, täte gut daran, den nahen Nachbarn nicht im Stich zu lassen. Denn die Welt wird wohl nur zur Normalität zurückfinden, wenn die Pandemie auch in Afrika besiegt wird. „Das Problem ist nicht gelöst, wenn es nur in Europa gelöst ist. Dann könnte es zu einem Rückschlag kommen“, sagt auch EU-Außenbeauftragter Josep Borrell.
Europa wäre wohl gut beraten, Afrika nicht nur im Gesundheitsbereich zur Seite zu stehen, sondern auch in der Abdämpfung der riesigen, sich abzeichnenden wirtschaftlichen Kollateralschäden. Auch hier können Eigeninteresse und Moral durchaus Hand in Hand gehen. Denn in der aktuellen Krise werden die Weichen für künftige politische und wirtschaftliche Beziehungen gelegt. In Sachen Beziehungspflege könnte sich Europa von China wohl einiges abschauen. Das Land, das im großen Stil in Afrika investiert, zeigt sich jedenfalls auch jetzt in schwierigen Zeiten als Helfer und Freund aktiv und präsent.