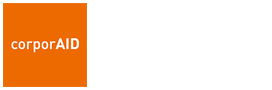Österreich steht wie fast die ganze Welt seit einem halben Jahr im Bann des neuartigen Coronavirus. Hier wie dort setzten und setzen Regierungen einschränkende Maßnahmen – für Individuen ebenso wie für Unternehmen. Diese müssen sich für das gemeinschaftliche Wohl mit der sogenannten neuen Normalität abfinden. Viele Menschen in Österreich sind dadurch das erste Mal bewusst mit einem Phänomen konfrontiert, das der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper „Social Engineering“ nannte und damit den technokratischen Versuch von Regierungen kritisierte, so etwas wie ideale Gesellschaften zu verwirklichen. Angesichts einer Situation, in der für niemanden abschätzbar war, ob und wie katastrophal sich alles entwickeln würde, traten viele Staaten nahezu in einen Wettstreit um die ideale Seuchenbekämpfung ein.
Eine Herausforderung war und ist es, die Menschen mitzunehmen – Ungewissheit und Autorität führen zu Unsicherheit und Zweifeln. Und lösen damit Widerstände aus, die schon für den mittelfristigen Erfolg der Maßnahmen nicht wirklich förderlich sind. Man kann hier keinen fundamentalen Vorwurf machen. Denn nicht nur befinden wir uns in einer Ausnahmesituation, es fehlt zudem an der Praxis im Social Engineering. Üblicherweise wird von europäischen Regierungen ja nicht die ideale Ordnung angestrebt, sondern mit starken Institutionen ein Rahmen geschaffen, damit Menschen praktische Probleme lösen können – zumindest, wenn es um Maßnahmen im eigenen Land geht.
Auch Menschen in Entwicklungsländern sind mit Ungewissheit konfrontiert. Anders als bei uns aber nicht nur im Angesicht einer Pandemie, sondern quasi als Teil des Tagesgeschäfts. Gleichzeitig sind sie Akteure und Passagiere in einem gewaltigen Prozess, den wir als globale Entwicklung kennen. Nur ist in vielen dieser Länder ein Vorgehen im Popper‘schen Sinne eher schwierig: Für die pragmatische Verbesserung des Alltags braucht es Institutionen, die nicht nur für eine Minderheit funktionieren. Und diese sind zumeist dünn gesät.
Gerade die Entwicklungszusammenarbeit ist in ihrem Bemühen, Wohlstand und Sicherheit für alle mit einer globalen Zukunftsperspektive zu verbinden, verführt, ideale Gesellschaften anstoßen und gestalten zu wollen. Ausgehend von der Überzeugung, besser zu wissen als die Menschen selbst, was gut für sie ist und wohin der Weg gehen soll. Für die globale Entwicklung ist das nicht von Vorteil. Entwicklungszusammenarbeit muss vielmehr der Verlockung widerstehen, das mögliche bessere Wissen um den Lauf der Dinge zu Besserwisserei werden zu lassen. Gute Entwicklungszusammenarbeit lebt immer auch von der Selbstbeschränkung – und der Gewissheit, dass Menschen letztlich niemals die ideale Ordnung realisieren werden.
Foto: Mihai M. Mitrea