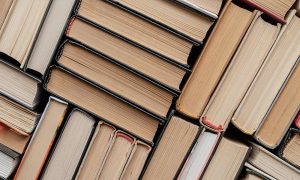Autor: Klaus Huhold.
In vielen Entwicklungsländern verschärft sich das Problem des unsachgemäß entsorgten Abfalls: Bis zu 40 Prozent des Mülls landen unkontrolliert in der Umwelt – oft über wilde Deponien oder durch offene Verbrennung. Dabei besteht ein erheblicher Anteil des Entsorgten, nämlich oft mehr als die Hälfte, aus organischem Material, das wiederum ein enormes Potenzial zur umweltfreundlichen Verwertung hätte. Der nötige Prozess dazu ist die Kompostierung – mit den Vorteilen, dass sie wertvollen Naturdünger erzeugt und zugleich hilft, Deponien zu entlasten, schädliche Methanemissionen zu verringern und Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu minimieren.
Wie viel Material ungenützt vermodert, offenbarte der kürzlich veröffentlichte Global Waste Management Outlook 2024 der Vereinten Nationen. Demnach werden in Subsahara-Afrika von insgesamt mehr als 200 Millionen Tonnen Haushaltsmüll lediglich rund vier Prozent recycelt, in Zentral- und Südasien sind es bei rund 300 Millionen Tonnen Siedlungsmüll auch nur zehn Prozent.
Mittlerweile setzen aber immer mehr Schwellen- und Entwicklungsländer auf die Nutzung organischen Abfalls: Auf den Philippinen hat die Regierung beispielsweise mit Unterstützung der Asiatischen Entwicklungsbank und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen das Organic Waste Composting Program ins Leben gerufen. Gemeinden erhielten Mittel, um kleinere Kompostieranlagen zu errichten, deren gewonnener Humus in der Landwirtschaft genutzt wird. In Kigali, der Hauptstadt Ruandas, sind Haushalte sogar bereits angehalten, ihren Abfall zu trennen. Die Stadt gilt heute als eine der saubersten in Afrika.
Daten und Fakten
Fast die Hälfte der globalen Abfallmenge ist organischen Ursprungs – es wird jedoch nur ein kleiner Teil effektiv verarbeitet.

Know-how weitergeben
Auch in Österreich ist es bis zur Verwertung von Haushaltsmüll im großen Maßstab ein längerer Weg gewesen, mit der Mülltrennung wurde hier 1992 begonnen. Es war ein Prozess des Lernens und Ausprobierens, bei dem über Jahre hinweg daran gearbeitet wurde, den Kompostierungsprozess zu optimieren und Stoffströme effizient zu trennen und zu verarbeiten. Genau diese Erfahrungen können nun in Schwellen- und Entwicklungsländer übertragen und an lokale Gegebenheiten angepasst werden.
Tatsächlich sind österreichische Firmen auch bereits in Kompostierungsprojekte in Entwicklungsländern involviert, so etwa die Firma Compost Systems aus Wels. Das Ingenieurbüro plant Müllverarbeitungsanlagen für Kunden auf der ganzen Welt und bietet dazu passende Anlagen-, Maschinen-, Container- und Messtechnik an. Im Rahmen von Projekten der deutschen GIZ und Bank für Wiederaufbau KfW oder dem Entwicklungs- oder Umweltprogramm der Vereinten Nationen war Compost Systems auch bereits an größeren Vorhaben im globalen Süden beteiligt.
Geschäftsführer Aurel Lübke berichtet etwa von einem Projekt in Äthiopien. Compost Systems war hier in die Beratung des äthiopischen Umweltministeriums zu Fragen der Kompostierung eingebunden und unterstützte danach die Errichtung von sechs Kompostieranlagen, unter anderem durch die Lieferung von Gerätschaften zur Abdeckung des Komposts und Ausrüstung zur Prozessüberwachung.
Auch das Maschinenbau-Unternehmen Komptech im steirischen Frohnleiten mit seiner Spezialisierung auf mechanisches und biologisches Abfallrecycling trägt zur Implementierung der Komposterzeugung in Entwicklungsländern bei, in Ghana mittlerweile im großen Stil. Denn auf den ersten Auftrag der Jospong-Gruppe, einem ghanaischen Mischkonzern, der mit etwa 5000 Mitarbeitern zu den größten Unternehmen im Bereich Abfallmanagement in der Region zählt, folgten weitere.
So stattete Komptech eine große mobile Anlage in der Hauptststadt Accra mit Maschinen aus und errichtete eine komplette stationäre Anlage in der Großstadt Kumasi. Für weniger dicht besiedelte Regionen lieferte das Unternehmen dezentrale, mobile Müllverarbeitungsanlagen. Der bisherige Auftragswert beläuft sich auf über 20 Millionen Euro.

Herausforderung Sammlung
In vielen Entwicklungsländern ist die Müllsammelstruktur ein großes Problem. Mehr als die Hälfte der Haushalte in Subsahara-Afrika sind laut UN-Daten nicht an die formelle Müllabfuhr angeschlossen. In armen Vierteln übernehmen oft informelle Sammler die Müllentsorgung. Das ist auch in Ghana der Fall.
Die Sammler holen die Abfälle gegen eine geringe Gebühr direkt von Haushalten ab, sortieren aber nur wiederverwertbare Materialien wie PET-Flaschen aus. Der Rest, einschließlich Bioabfall, wird auf Deponien abgeladen, wo die Sammler für die Entsorgung zahlen müssen. Das macht es für sie attraktiv, auch einmal Müll am Weg zu entsorgen, ihn auf Feldern oder am Straßenrand liegen zu lassen. In wohlhabenderen Gegenden gibt es eine formelle Müllabfuhr, doch oft dauert es lange, bis die Tonnen entleert werden, was den Kompostierungsprozess erschwert.
Wenn der Müll zu lange in den Containern liegt, „ist der biologische Anteil nicht mehr so aktiv und es ist oft schwer, den Kompostierungsprozess zu starten“, erklärt Andreas Kunter, Projektmanager bei Komptech, der für das Knowledge Management zuständig ist. Man erreicht schwerer die notwendigen Temperaturen, damit Mikroorganismen die organischen Abfälle in Kompost verwandeln können. Und wenn der Abfall auch durchnässt ist, macht es die Aufgabe noch schwerer.

Mülltrennung in Anlage
Dann muss der Müll in der Anlage noch getrennt werden, da in Ghana Hausmüll meist vollständig gemischt eingesammelt wird. Dafür sind mechanisch-biologische Aufbereitungsanlagen unverzichtbar, erklärt Kunter. Solche Anlagen, die im deutschsprachigen Raum kaum noch eingesetzt werden, sind in Schwellen- und Entwicklungsländern die einzige Möglichkeit, um organische Abfälle und Wertstoffe aus gemischtem Müll zu gewinnen.
Die verwendeten Geräte sind jedoch oft dieselben wie in anderen Regionen. Terminator nennt sich etwa ein Zerkleinerer, der für fast alle Abfallarten einsetzbar ist. Ballistor heißt eine Separationsmaschine, die den Müllstrom nach physikalischen Eigenschaften auftrennt, um Wertstoffe zu separieren.
In den Anlagen in Ghana wird zunächst das gesamte Material sortiert: Abfälle, die größer als 80 Millimeter sind und in der Regel nicht organisch, werden händisch an Fließbändern oder durch Siebmaschinen entfernt. Anschließend wird der verbleibende Abfall gereinigt, um Sand, Steine und andere Störstoffe zu entfernen, die den Kompostierungsprozess behindern. Eine optische Endkontrolle stellt sicher, dass keine Fremdstoffe wie Batterien im organischen Anteil verbleiben.
Der so gewonnene organische Abfall geht dann in die Kompostierung. „Sie ist so angelegt, dass das Material in Boxen vortrocknet und ankompostiert“, erklärt Kunter. Nach ein bis zwei Wochen geht der organische Abfall in die sogenannte offene Miete. Grob gesprochen sind das große Komposthaufen, die dann von Umsetzmaschinen gewendet und gelockert werden. In acht bis zehn Wochen ist der Kompostierungsprozess abgeschlossen. „Bei gemischtem Müll ist es aufwendiger, eine gute Kompostqualität herzustellen, daher ist eine Nachreinigung durch eine Feinsiebung unumgänglich“, so Kunter.

Unterstützung nötig
Damit organischer Abfall in nutzbaren Kompost umgewandelt werden kann, müssen einige Strukturen geschaffen werden – viele Entwicklungsländer befinden sich gerade in diesem Aufbauprozess. „Es geht nicht darum, etwas Neues aufzubauen, sondern die vorhandene Infrastruktur gezielt zu verbessern“, erklärt Agnieszka Kuderer, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Müllmanagement an der TU Wien. Sie forscht zu Kreislaufwirtschaft und Müllmanagement, hat dafür schon Untersuchungen in Tansania durchgeführt und unterrichtet nun an der Waste Academy in Ghana. Diese vermittelt Fachwissen zur Müllverarbeitung an alle, die in diesem Bereich direkt oder indirekt tätig sind, und schult das Personal der Jospong-Gruppe im effizienten Einsatz der österreichischen Maschinen.
Eine zentrale Herausforderung, die bei den Schulungen zu Tage trat, ist die unzureichende Datenlage. „Mit besseren Daten könnten Müllabholrouten deutlich effizienter geplant werden“, so Kuderer.
Generell kann eine umweltfreundliche Müllverarbeitung und eine Förderung der Kreislaufwirtschaft nur funktionieren, wenn dies auch von der Politik gewollt ist und sich für die Betreiber wirtschaftlich rechnet, betont die Forscherin. Für die Jospong-Gruppe geht es unter anderem darum, dass der von ihr hergestellte und mit Nährstoffen angereicherte Kompost in der Lage sein muss, die Landwirte zu überzeugen und mit herkömmlichem Dünger preislich zu konkurrieren.
Internationale Initiativen unterstützen eine nachhaltigere Müllverarbeitung in Entwicklungsländern. So bietet der Circular Economy Action Plan der EU Fördermittel an, und die Weltbank stellt über das Programm More Growth, Less Garbage Millionen aus dem Fonds für nachhaltige Entwicklung bereit. Allerdings sind diese Gelder und Programme nicht spezifisch für Entwicklungsländer vorgesehen, sondern müssen projektbezogen aus unterschiedlichen Töpfen beantragt werden.
Aurel Lübke von Compost Systems sieht im Emissionshandel eine weitere Möglichkeit, Müllentsorgung wirtschaftlich attraktiver zu machen. „Wir arbeiten derzeit daran, dass wir die Treibhausgaseinsparungen, die wir in den Deponien erreichen, verkaufen – in Europa und anderen Ländern, die das Kohlenstoffdioxid in die Luft blasen.“ Allerdings sei der Emissionshandel mit Zertifikaten ein schwankendes und risikoreiches Geschäft, es sei schwer, langfristige Abnehmer zu finden.

Starkes Umweltargument
Der Nutzen der Kompostierung für Umwelt und Natur liegt im Wesentlichen in einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen des Abfallsektors, da bei der aeroben Zersetzung von organischem Abfall hauptsächlich Kohlenstoffdioxid (CO₂) freigesetzt wird – ein regeneratives CO₂, das beim biologischen Abbau entsteht. Im Gegensatz dazu führt die unkontrollierte Zersetzung auf Deponien zur Bildung von Methan, einem Treibhausgas mit einer rund 80-mal höheren Klimawirkung als CO₂ in den ersten 20 Jahren nach der Freisetzung.
„Mit unseren Projekten wollen wir auch zeigen, wie man unter den jeweiligen Bedingungen vor Ort aktiv zum Klimaschutz beitragen kann“, erklärt Andreas Kunter von Komptech. Darüber hinaus hebt Aurel Lübke, Geschäftsführer von Compost Systems, einen weiteren Vorteil hervor: Der aus dem organischen Abfall gewonnene Humus liefert dem Boden wertvollen Kohlenstoff. „Während CO₂ in der Atmosphäre ein Problem ist, bildet es im Boden eine essenzielle Grundlage für das Leben“, so Lübke. Der Kohlenstoff im Humus verbessert die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens und hilft, ihn vor Versteppung zu schützen – ein entscheidender Beitrag zur Resilienz der Böden angesichts des Klimawandels.
Neue Aufträge gesichert
Die beiden österreichischen Unternehmen haben jedenfalls bereits die nächsten Aufträge in Entwicklungsländern gesichert. Zum einen hat das Unternehmen Fima Industries kürzlich in Nigeria einen Auftrag über 20 Millionen Euro an Land gezogen. Gegründet wurde Fima vom ehemaligen Komptech-Mitarbeiter Markus Maierhofer, der nun selbstständig Projekte in Westafrika vorantreibt. Im Rahmen dieses neuen Projekts werden in der Millionenstadt Lagos innerhalb der nächsten zwölf Monate zwei Aufbereitungsanlagen für Haushaltsabfälle errichtet. Auch hier liefert Komptech die Maschinen, während die Jospong-Gruppe als Abnehmer fungiert.
Zum anderen arbeitet Compost Systems bereits an einem Auftrag in Mauritius. Hier werden zwei Anlagen mit einer jährlichen Kapazität von jeweils 130.000 Tonnen Abfall errichtet. Diese werden vom lokalen Konzern Sotravic gemeinsam mit der öffentlichen Verwaltung betrieben. Compost Systems ist Partner beim Bau und der Planung der Anlage. „Außerdem liefern wir technologierelevante Komponenten, etwa die Prozesstechnik, die Steuerung, die Software, spezielle Lüfter oder Biofilter zur Luftreinhaltung“, erklärt Lübke.
Die internationale Nachfrage nach österreichischem Know-how im Bereich Kompostierung wächst. „Die Kompetenz, die wir in Österreich aufgebaut haben, ist im Ausland einiges wert“, erklärt Aurel Lübke von Compost Systems. Es gärt zusehends in den Müllanlagen in Entwicklungsländern – und Österreich gilt als internationales Vorzeigeland bei der Kompostierung. „Dieses Wissen können wir nun unseren Partnern und Kunden anbieten“, sagt Lübke.