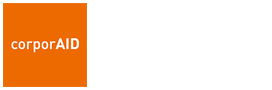In Bougainville steht der Wunsch nach Unabhängigkeit in voller Blüte: Auf der 250.000 Einwohner umfassenden melanesischen Insel, die wie die farbenfrohe Kletterpflanze nach dem französischen Weltumsegler Louis Antoine de Bougainville benannt wurde, haben sich bei einem Referendum Ende 2019 knapp 98 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit von Papua-Neuguinea entschieden. Damit könnte Bougainville das neueste Mitglied im Klub der selbstständigen Staaten werden.

Der Stein des Anstoßes war dabei aus Kupfer: Bougainville und die Regierung Papua-Neuguineas stritten jahrzehntelang über die Verteilung des Gewinns aus der Panguna-Mine in Zentral-Bougainville, ehemals die zweitgrößte Kupfermine der Welt und Haupteinnahmequelle Papua-Neuguineas – ein Konflikt, den es in vergleichbarer Form im Südsudan oder in den 1960er Jahren im kongolesischen Katanga und im nigerianischen Biafra gab. Wie in jenen verhängnisvollen Konstellationen wuchsen sich die Spannungen auch in Bougainville zu einem brutalen Bürgerkrieg aus, der in zehn Jahren fast 20.000 Opfer – zehn Prozent der Bevölkerung Bougainvilles – forderte. Ein Waffenstillstand und mehrjährige Verhandlungen mündeten 2001 schließlich in ein Friedensabkommen, das im Kern ein Unabhängigkeitsreferendum zwischen 2015 und 2020 vorsah.

Das klare Ergebnis des Referendums reicht für die Unabhängigkeit nun aber nicht aus, das letzte Wort liegt beim Parlament von Papua-Neuguinea. Derzeit wird über Grenzen, Handel, Diplomatie und Sicherheit geredet, die Verhandlungen könnten Jahre dauern. Volker Böge, Konfliktforscher an der University of Queensland im australischen Brisbane und ausgewiesener Bougainville-Kenner, erwartet, dass es letztlich zur Unabhängigkeit kommt. Ob diese insbesondere wirtschaftlich gesehen so eine gute Idee ist, ist aber zweifelhaft, denn Bougainville ist stark von den Geldern der Zentralregierung abhängig. Für die Menschen in Bougainville ist das aktuell nebensächlich: „Die Bougainvilleaner argumentieren so: Wir haben 20.000 Menschenleben in diesem Krieg verloren und für unsere Unabhängigkeit mit Blut bezahlt. Rationale Erwägungen wie die Wirtschaftlichkeit spielen erst einmal keine Rolle“, sagt Böge.
Steiniger Pfad
Auch wenn rational vielleicht nicht immer leicht nachzuvollziehen: Weltweit setzen sich zurzeit 60 Unabhängigkeitsbewegungen für eine staatliche Eigenständigkeit ein – von Abchasien bis Nordzypern. Großes Ziel ist dabei jeweils ein voller Sitz in der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Dabei ist die Mitgliedschaft nicht so sehr als Bedingung für Staatlichkeit, sondern mehr als eine Art Gütesiegel zu verstehen – die Schweiz beispielsweise ist den Vereinten Nationen erst 2002 beigetreten.
Der Weg dorthin ist für Unabhängigkeitsbewegungen jedenfalls steinig. Zumindest neun der 15 Sicherheitsratsmitglieder müssen der Unabhängigkeit zustimmen, und keines der fünf ständigen Mitglieder darf ein Veto einlegen. Die größte Hürde ist aber die Frage, ob der Staat, von dem die Abspaltung angestrebt wird, den Daumen hebt oder senkt – der Sicherheitsrat hält sich gemeinhin an diese Entscheidung.
Die jüngsten Mitglieder der Vereinten Nationen sind der Südsudan (2011), Montenegro (2006) und Osttimor (2002). Was die drei eint und auch für Bougainville gilt: Der Unabhängigkeit gingen jeweils kriegerische Auseinandersetzungen voraus – im Falle Montenegros nicht unmittelbar, dennoch waren die Jugoslawienkriege für die Eigenstaatlichkeit entscheidend. Auch wenn die großen Länder und Organisationen Unabhängigkeitsbewegungen stets Gewaltverzicht empfehlen, bleibt Wohlverhalten häufig unbelohnt: Das weitgehend friedliche und stabile Somaliland etwa wird von keinem Staat anerkannt. Der Südsudan hat hingegen internationale Anerkennung erreicht, und das obwohl während des Bürgerkriegs Völkerrecht und Menschenrechte in gravierender Weise verletzt wurden.
Um die Aussichten von Unabhängigkeitsbewegungen ist es dabei zweifellos besser bestellt, wenn die administrative Gliederung des Staates die Abtrennung erlaubt, ohne einen größeren Präzedenzfall zu schaffen. Das heißt im Klartext: Der neue Staat besteht bereits als mehr oder weniger autonome Region. Demnach könnte Schottland unabhängig werden, die Grafschaft Cornwall aber nicht. Die Grenzen für potenzielle neue Staaten sind also zumeist bereits gezogen. Sezessionistische Gruppen, die nicht mit autonomen Regionen zusammenfallen, haben kaum Chancen auf eine friedliche Abspaltung.
Am Beispiel der Auflösung der Sowjetunion wird das Prinzip noch klarer: Sowjetrepubliken wie die Ukraine oder Usbekistan wurden unabhängig, während den innerhalb solcher bestehenden sogenannten autonomen Sowjetrepubliken wie Tschetschenien oder Abchasien der Wunsch nach Eigenstaatlichkeit verwehrt wurde. Abchasien, vor 1991 autonomer Teil der georgischen Sowjetrepublik und heute wie Somaliland ein etabliertes De-facto-Regime, hält an seinem Bestreben fest, wird aufgrund des georgischen Widerstandes jedoch nur von wenigen Staaten anerkannt. Ein vermutlich schwacher Trost: Abchasien konnte 2016 den Weltmeistertitel des 47 Mitglieder umfassenden Fußballverbandes für staatenlose Nationen erringen. Aktueller Titelträger ist übrigens Transkarpatien (Ukraine), nachdem es Nordzypern im Elfmeterschießen schlug.
Interview mit Ryan Griffiths, Syracuse University
Partei oder Panzer
Ende der Fragmentierung
Vor dem Ersten Weltkrieg, am Höhepunkt des imperialistischen Zeitalters, das durch die stetige Expansion der Großmächte geprägt war, gab es rund 50 souveräne Staaten, heute haben die Vereinten Nationen 193 volle Mitglieder. Lässt sich voraussagen, welche neuen Staaten zukünftig auf der Weltkarte zu finden sein werden? Ganz so einfach ist es nicht, denn der internationale Trend hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wieder zu Ungunsten der Unabhängigkeitsbewegungen gedreht.

Entscheidend für den Übergang von einer Ära der Staatsaggregation zu einer Ära der Fragmentierung waren die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Basis dazu boten die weithin akzeptierten Standards für Staatlichkeit, welche 1933 in der Konvention von Montevideo festgelegt worden waren. Dazu zählen eine ständige Bevölkerung, ein definiertes Staatsgebiet, eine Regierung und die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Staaten aufzunehmen. Vor allem die USA, die stark auf die Selbstbestimmung der Völker pochten, leisteten den Unabhängigkeitsbewegungen in der Mitte des 20. Jahrhunderts starke Unterstützung.

Nach dem Ende der Hauptwelle der Dekolonisation in den späten 1960er Jahren erhielten dann aber machtpolitische Faktoren und Interessen zunehmend Vorrang vor vermeintlichen Prinzipien. Abzulesen ist dies etwa am Westsahara-Konflikt: Zu dem bereits 1991 beschlossenen Referendum über eine Unabhängigkeit der Westsahara von Marokko ist es bis heute nicht gekommen, die Europäische Union hält sich entweder zurück oder unterstützt ausdrücklich Marokko – zu wichtig ist die Beziehung zu dem nordafrikanischen Land in wirtschaftlichen und Migrationsfragen. Dazu kommt, dass auf dem internationalen Parkett Staaten wie China und Indien an Gewicht gewinnen, die, was die Anerkennung neuer Staaten angeht, mit Blick auf mögliche Unabhängigkeitsbewegungen im eigenen Land auch international eher ablehnend auftreten.

Und bei den Vereinten Nationen fand ebenfalls ein Umdenken statt. Der ehemalige VN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali betonte bereits 1992, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker keinen Anspruch auf eigene, neue Staaten bedeute, sondern sich – von einigen Sonderfällen abgesehen – auf die Gewährung von Minderheiten- und Autonomierechten innerhalb eines bestehenden Staates beziehe.
Schlechte Vorbilder
Es ist also davon auszugehen, dass sich das Tempo an Staatsneugründungen weiter verringert – vielleicht auch, weil die Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten eher abschreckend sind. So gilt der Kosovo, der sich 2008 einseitig als von Serbien unabhängig erklärte, für viele Unabhängigkeitsbewegungen, etwa in Berg-Karabach (Aserbaidschan) oder Transnistrien (Republik Moldau), zwar als eine Art Präzedenzfall. Im Jahr 2010 besagte ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, dass einseitige Unabhängigkeitserklärungen im Allgemeinen und die des Kosovo im Besonderen dem Völkerrecht nach nicht illegal sind. Doch hat das Land noch immer keinen Antrag auf Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen gestellt, da Russland diesem mit Verweis auf Serbiens Widerstand nicht zustimmen würde. Außerdem wird der De-facto-Staat heute durch Armut, fehlende Rechtsstaatlichkeit und Korruption zerrieben.
Zugleich versinkt der unabhängige Südsudan in Bürgerkrieg und Hungersnot, während im Sudan vorsichtig von einer demokratischen Zukunft geträumt werden darf. Daneben hat Osttimor zwar deutliche Erfolge bei der Demokratisierung und Friedenskonsolidierung zu verzeichnen, die Wirtschaft krankt aber an der totalen Abhängigkeit von Ölexporten und grassierender Korruption. Es droht ein tiefer Fall, wenn die Ölvorkommen schwinden. Der Preis für die Freiheit ist hoch: Nach Abklingen der ersten Unabhängigkeitsfreude herrscht Absturzgefahr, dazu stellen fehlende funktionierende Staatswesen und weitere separatistische Aufspaltungen wiederkehrende Phänomene dar.
Alternative: Zusammenwachsen
Es stellt sich die Frage, ob der Sezessionismus noch eine zeitgemäße und vor allem sinnvolle Vorstellung ist. Geht es dahinter liegend nicht vor allem um Bürgerrechte, Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Forderungen an den Staat, transparent und fair zu sein? Ein multiethnischer Staat kann seinen Bürgern dienen, wenn er diese Faktoren beachtet und dadurch ein Zusammenwachsen der Bevölkerung fördert, eine immer weiter gehende Aufspaltung anhand ethnischer Kategorien ist, milde ausgedrückt, kein Garant für ein besseres Leben.
In Bougainville sieht man das heute freilich anders. Der fragile Frieden auf der kleinen Insel hängt nun an der Entscheidung Papua-Neuguineas über ihre Unabhängigkeit. Einige Regierungsmitglieder haben bereits signalisiert, dass ihnen lieber wäre, wenn Bougainville nicht die volle Unabhängigkeit erlangte. Doch angesichts des mit großem Aufwand und internationaler Expertise durchgeführten Referendums wird es für die Regierung schwierig sein, das klare Votum für die Unabhängigkeit zu verweigern, ohne weitere Zusammenstöße zu riskieren.
Das grundlegende Dilemma der Sezessionisten bleibt dort wie überall bestehen: Sie wollen souverän sein und territoriale Anerkennung genießen, bekämpfen aber gleichzeitig die Souveränität und territoriale Integrität des Staates, von dem sie sich loseisen wollen.